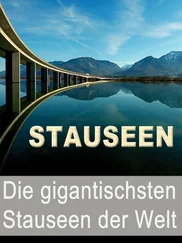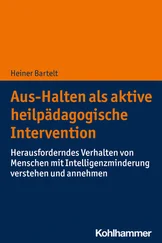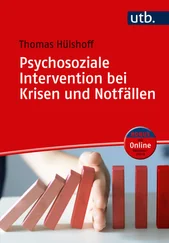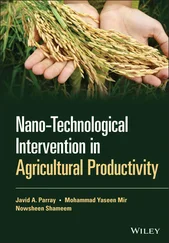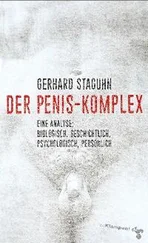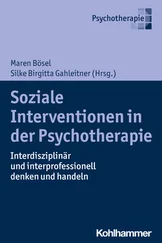Denn einerseits lebt der Begriff der Intervention vom Auftrag zu Wirksamkeit, Direktheit und Transformation durch ein nunmehr explizit ins Feld des Politischen und Sozialen ausgeweitetes künstlerisches Tun, beschreibt andererseits aber ein Handeln, das notwendig im Feld des Ästhetischen verankert bleiben muss. So sind es letztlich die Ambivalenzen und Aporien der Sphäre des Ästhetischen selbst, des nur scheinbar fest umrissenen Felds der Kunst, die von Interventionen aufgestört und sichtbar gemacht werden. Das bedeutet zugleich, dass künstlerische Interventionen die Stabilität jener Institutionen, aus denen heraus sie operieren, geradezu voraussetzen.
Weil die Institutionen ihnen die Macht über die Verhältnisse, in die sie eingreifen, überhaupt erst verdanken, müssen sie notwendig zu ihnen zurückkehren, um überhaupt künstlerische Interventionen zu bleiben. Ein kurzer Blick in die Geschichte dezidiert politischer Theaterpraktiken illustriert diese komplexe Verwicklung von Distanzierung und Wiedereintritt in das Reich der Kunst: Erwin Piscator, der das politische Theater vom Begriff her erfindet, erträgt, aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt, die bürgerliche Schauspielerei, die sein Beruf war, nicht mehr und wendet sich stattdessen dem Agitprop zu. Damit stellt er sich zugleich in den Dienst der Partei, eröffnet mit finanzieller Unterstützung eines Industriellen nur wenige Jahre später die Piscator-Bühne und dadurch ein Theater, das die Welt wieder, wenn auch mit neuen Mitteln, abbildet. Ganz ähnlich halten es die historischen Avantgarden, deren programmatische »Aufhebung der autonomen Kunst im Sinne einer Überführung der Kunst in Lebenspraxis« 9 hauptsächlich in den Stätten der Kunst verbleibt. Bereits vor ihnen ist es Richard Wagner, der im Geist der Revolution zwar das »große Gesamtkunstwerk« 10 als das Kunstwerk der Zukunft erträumt, mit seinem ›Bühnenweihfestspiel‹ schließlich sogar an der Neuerfindung des Ritus arbeitet, letztlich aber doch (nur) Theater macht.
Die Strategien zur Überwindung der Trennung von Kunst und Leben sowie der Teilung in die Tätigkeiten des Vorspielens und Zuschauens zugunsten der Inszenierung von ›direkter Aktion‹ werden im Laufe des 20. Jahrhunderts vielfältig. Augusto Boals Programmatik, das Theater tatsächlich ›unsichtbar‹ zu machen oder, mehr noch, seine Methode des Forumtheaters will das Publikum tatsächlich zum aktiven Gestalter von szenischen Umwelten formen und zu gesellschaftlich verantwortlicher Handlungsfähigkeit ›erziehen‹. 11 Im Living Theatre rund um Julian Beck und Judith Malina oder in der experimentellen Performance-Group von Richard Schechner tritt das Publikum ebenso aktiv in die Handlung ein und agiert exemplarisch gesellschaftliche Rollenzuschreibungen kritisch aus, ohne allerdings das Theater dabei zu verlassen. Marina Abramović und andere Vertreter:innen der Body Art, die sich nicht nur selbst ins Fleisch schneiden, sondern mit diesem Schnitt prekäre Präsenzen erzeugen, um sich der Repräsentation und Reproduktion vorderhand zu entziehen, setzen seit jeher alles daran, um ihr Vorkommen im kulturellen Gedächtnis medial zu garantieren. 12 Die Interventionen im postdramatischen Theater seit den 1980er Jahren wiederum, die darauf zielten, den Einsatz des Theaters selbst ins Spiel zu bringen, erscheinen zunehmend als in sich selbst gefangen. 13 Schlingensief schließlich, der wie bereits angedeutet, vielleicht am vorläufigen Ende einer Entwicklung steht, gründet mit Chance 2000 zwar eine echte Partei, treibt allerdings mit der zentralen Forderung, sich selbst zu wählen, ein intrikates Spiel um Selbstwirksamkeit und gesellschaftlichen Zugriff, das der Politik notwendig fremd und im Bereich der Kunst verankert bleiben muss. 14
Die Dramaturgie der künstlerischen Intervention ist insofern der Heldenreise, dem Joyce’schen Monomythos, nicht ganz unähnlich. 15 Den Auftakt bildet die Bestimmung eines Mangels und einer Aufgabe, der zum Überschreiten der Schwelle in eine Welt (außerhalb der Kunst) führt. Diese ist zunächst insofern fremd, als dass die bekannten Handlungsroutinen hier (in einem anderen Sozialsystem) nicht mehr gültig sind. Es folgt das Abenteuer, das sich als eine Reihe von Prüfungen gestaltet, in denen es gilt, dem und vor allen den Unbekannten (Aktanten) zu begegnen. Die Reise gipfelt schließlich in der Apotheose des maskulin konstruierten (Künstler-)Helden, der an diesen Begegnungen gewachsen ist. So steht am Ende die Rückkehr des gereiften Helden, dessen Schatz an (Welt-)Erfahrung schließlich die von ihm zurückgelassene (Kunst-)Welt in eine neue Freiheit führt. Es sind Berufung (Definition der Krise), Abenteuer (Kontingenz der Situation) und Heimkehr (Transformation des Systems), aus denen sich Interventionen zusammensetzen und auf die sie sich befragen lassen: Somit stellt sich, erstens , die Frage nach der diskursiven Politik und der epistemischen Gewalt, die mit der Bestimmung der Verhältnisse wirksam wird: Wie stellen Interventionen die Welt dar, in die sie sich einmischen? Zu fragen ist, zweitens , nach den Strategien der Kontingenzbewältigung: Verstopfen sich Künstler:innen die Ohren und schlagen das Gegenüber symbolisch tot, um Kurs auf ihrer ›Reise‹ zu halten und Autorität zu wahren, oder setzen sie die eigene Identität auf’s Spiel und verhalten sich insofern ver-antwortlich? Drittens schließlich steht die Frage nach dem, was bleibt und dem, was wird nach der Rückkehr, kurz: nach dem Wiedereintritt in die Kunst. Bringt das Ende der Weltläufigkeit also etwas anderes als Distinktionsgewinne und neue Grenzschließungen? Hat sich nachhaltig etwas verändert im Verhältnis von Kunst und Welt? Da Interventionen immer Transgressionen sind, wenn vielleicht auch nur temporäre, haben die Fragen, die sie provozieren, sowohl eine ästhetische als auch eine ethische Dimension. Vielleicht bestünde das eigentliche Potential der künstlerischen Intervention deshalb gerade darin, die Frage nach den Konsequenzen in jene Sphäre zurückzutragen, die maßgeblich aus der eigenen Konsequenzlosigkeit heraus operierte. 16
Durch einen zeitgenössisch verstärkt politisch-aktivistischen Zu- und Angriff auf die Institution Theater wie umgekehrt durch die forcierte Ausweitung von Theatern hin zu gesellschaftskritischen Konfrontations- und integrativen Begegnungsräumen ist das Etikett der Intervention mittlerweile für ein institutionelles Selbstverständnis von Engagement attraktiv geworden. So können etwa institutionskritische Überschreibungs- und Aneignungsstrategien Gegenentwürfe zu normativen Repräsentations-, Besetzungs- und Wahrnehmungspolitiken vornehmen, indem sie dominante Funktionsweisen im »ästhetischen Regime« des Theaters offenlegen, das mit Jacques Rancière auf einer spezifischen »Aufteilung des Sinnlichen« 17 beruht, die den jeweils geltenden Raum des Sicht- und Sagbaren bestimmt und nach außen hin abgrenzt. Der Begriff der Intervention im Theater kann sich dabei weder auf eine klar konturierte Theoriebildung noch auf eine Vielzahl an einschlägigen Referenzfiguren und -praktiken berufen, sondern markiert in einem recht breiten und ungefähren Sinn einen Anspruch auf Wirksamkeit. 18
Eine erhellende Vergleichskonstellation eröffnet der Blick auf den Bereich der bildenden Kunst und der Performance, wo der Interventionsbegriff seit den 1990er Jahren zunehmend Verwendung findet. Er fungiert dort als lose Sammelbezeichnung für ästhetische Manifestationen, die sich dem Phantasma der unbeteiligten Kritik offensiv widersetzen und auf ein hohes Maß an Sichtbarkeit außerhalb der elitären Kunstschauplätze abzielen. Die von unterschiedlichen Kunstakteur:innen geforderte Inversion einer »depoliticizied celebration of surface« 19 zugunsten einer Reklamation von gesellschaftlicher Wirksamkeit soll sich nunmehr in ›ergebnisoffenen Projekten‹ artikulieren. Im Bestreben, »künstlerische Praxis als ein gesellschaftliches Handlungsformat« 20 zu performieren, gerät dabei der pragmatische Aspekt des Kunstgeschehens zunehmend ins Zentrum des Interesses.
Читать дальше