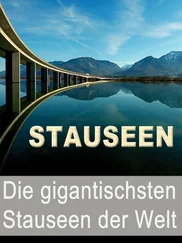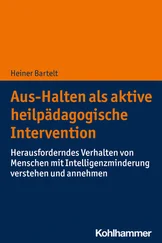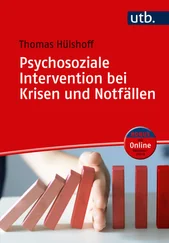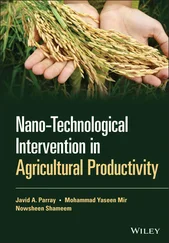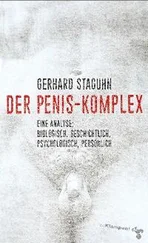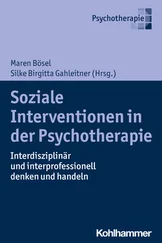Sandra Umathumgeht in ihrer Argumentation vom appellativen Charakter von Interventionen aus: Intervention zielt auf ein Antwortgeschehen und erzeugt Öffentlichkeiten, in denen widerstreitende Positionen hörbar werden. Das für die Entstehung von Öffentlichkeit konstitutive Antworten, das Kundtun einer Meinung allerdings, so zeigt sich mit Blick auf die Kunstform Theater, stellt sich nicht einfach so ein. Mit Bezug auf Oliver Marcharts konfliktuelle Konzeption des Ästhetischen fokussiert Umathum deshalb jenes Phänomen des Widerstreits von Positionen, das dem Begriff der Intervention erst Sinn verleiht. Die mediale Resonanz ist insofern notwendiger Bestandteil, nicht aber Selbstzweck von Interventionen und erübrigt sich, wie die Autorin an der (gescheiterten) Intervention Sucht nach uns! (2019/20) des Zentrums für Politische Schönheit (ZPS) zeigt, wenn die Antagonisierung vor Ort ausbleibt. Im Gegenzug dazu erscheint etwa Christoph Schlingensiefs Bitte liebt Österreich in seiner unhintergehbaren Evokation von Dissens als exemplarische, wenn auch mittlerweile historische Intervention. Das Dispositiv des Theaters, das ein Antworten prinzipiell selbst dann unwahrscheinlich macht, wenn es dazu auffordert, wie Umathum zu Beginn des Beitrags am Beispiel einer Arbeit von Terre Thaemlitz zeigt, erlangt seine Relevanz daher vielleicht gerade aus der Fähigkeit, den Widerstreit zu verzögern und zu verschieben.
Simone Niehoffwidmet sich ebenfalls der Aktion Sucht nach uns! des ZPS, die bereits bei Umathum als Beispiel für das Scheitern von Interventionen fungiert. Als zentraler theoretischer Referenzpunkt dient der Autorin das völkerrechtliche Verständnis von Intervention als übergriffige und illegitime Transgression einer nationalen Souveränität. Gerade der »aggressive Humanismus« 42 , den das ZPS als Operationsmodus selbstbewusst in Anschlag bringt, zeigt in seiner militaristischen Rhetorik und seinen fragwürdigen Legitimationspraktiken starke Parallelen zum Modell staatlicher Interventionen. Was das ZPS mit völkerrechtlichen Interventionen dabei im Wesentlichen teilt, ist das Neutralitätsphantasma und damit den Glauben, außen stehend und selbst unantastbar im Namen derer agieren zu können, deren Stummheit dadurch sowohl vorausgesetzt als auch hergestellt wird. Weder die Grenzüberschreitung noch die Verletzungen, die von der Aktion Sucht nach uns! ausgehen, lässt die Intervention unterdessen scheitern. Vielmehr, darin argumentiert Niehoff in die ähnliche Richtung wie Umathum, liegt im Bemühen darum, die Kontrolle über das Narrativ durch die Eingrenzung der Handlungsspielräume zu behalten und so die reaktive Prozesshaftigkeit zu unterbinden, die regelrecht künstlerische Negation der Aktion.
Lars Kochweist ebenfalls darauf hin, dass die Partizipation in den Arbeiten des ZPS präfiguriert ist und der Inszenierung der Aktivisten-Persona Philipp Ruch untergeordnet wird. In den Mittelpunkt der vom Autor so bezeichneten ›Erlebnisszenarios‹ gerückt, begründet sich deren Attraktivität primär aus der Verbindung von Komplexitätsreduktion und Selbstvalorisation. In einem close reading der ›Interpretationsmanuale‹ von Philipp Ruch/ZPS, Milo Rau/IIPM und Friedrich von Borries/RLF untersucht Koch die Strategien der Markenbildung und des Medienhandelns, die der Inszenierung der Persona des Artivisten wie der Performanz von Autorschaft im Kontext medialer Aufmerksamkeitsökonomie wesentlich zugrunde liegen. Im Zuge dieser Analyse zeigt sich nicht nur, dass sowohl Rau als auch Ruch sich vornehmlich in einer dezidierten Abgrenzung von der Postmoderne profilieren, sondern dass hinter den Gewaltanalysen und kritischen Durchdringungen von Öffentlichkeiten in den einzelnen Arbeiten letztlich das affektive Identifikationsangebot des authentischen Intellektuellen zentral bleibt. Demgegenüber vermag Friedrich von Borries’ von seinem Roman RLF (2013) ausgehendes Kunstprojekt aus der Sicht Kochs ein Experimentierfeld zweiter Ordnung zu kreieren, das in der überaffirmativen Reinszenierung aktivistischer Pathosformeln die Konsumierbarkeit von Subversion reflektiert und, an Schlingensief geschult, ein ironisches Spiel mit doppeltem Boden betreibt. Im 2021 veröffentlichen Roman Fest der Folgenlosigkeit erfährt diese Produktion von Ambiguität wiederum eine entscheidende Akzentverschiebung. Eingelassen in ein transmediales Setting hinterfragt das Projekt die gesellschaftliche Übereinkunft einer Verantwortungsdelegation der ökologischen Krise an Politik und Wirtschaft und erscheint aus der Perspektive Kochs deshalb als radikale Intervention in das gesellschaftlich Imaginäre.
Johanna Zornreflektiert in ihrem kunsttheoretischen Beitrag ebenso das Mittel der Ironie und macht es für einen performativen Selbstwiderspruch interventionistischer Praktiken fruchtbar. Als Praxis eines Intervenierens gegen seinen eigenen Begriff zeigt sich das Modell der Intervention, weil das eingreifende und entgegentretende Kunsthandeln einerseits die Trennung der Sphären von Kunst und Politik auslösen will, andererseits aber die Trennbarkeit dieser Bereiche markiert. So ruft der Interventionen eigene Anspruch einer Transgression des Ästhetischen ins Politische mit Zorn den Dualismus von ›Kunst‹ und ›Politik‹ erst ins Leben. Beruhen die Strategien zusätzlich noch auf der eindeutigen Rede, die den Anspruch auf gesellschaftliche Wirksamkeit einlösen soll, erodiert das emanzipatorische Potential von Kunst und ihr kritischer Begriff bleibt leer. Zur Veranschaulichung dieses dialektischen Zusammenhangs geht der Beitrag von Marc Antons Grabrede aus Shakespeares Julius Cäsar aus, einem demagogischen Glanzstück der Rhetorik, das seine Wirkung nicht aus der Eindeutigkeit, sondern gerade aus dem Verbergen und Unkenntlichmachen der eigenen Haltung ( dissimulatio ) in der Tradition der Ironie ( eironeia ) entfaltet. Anhand der von Marc Anton rhetorisch funktionalisierten, unauflöslichen Spannung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, Ausdruck und Maskierung erinnert die Autorin schließlich an einen Modellfall des uneindeutigen Sprechens in der Geschichte der Intervention: Christoph Schlingensiefs Container-Aktion Bitte liebt Österreich aus dem Jahr 2000.
Benjamin Wihstutzkonstatiert, ähnlich wie Koch, eine Abwendung vom über lange Zeit vorherrschenden Politikbegriff der Postdramatik. Er verortet die Intervention daher im Kontext einer Konjunktur des Aktivismus im Gegenwartstheater, die er in engen Zusammenhang mit der Diversifizierung der theatralen Publika und den daraus entstehenden Initiativen gegen Diskriminierung setzt. Zentral für die Intervention als Spielart eines solchen aktivistischen Theaters ist aus Wihstutz’ Sicht ein fundamentales Kippmoment, das sich durch einen Rahmenwechsel auszeichnet und dazu führt, dass die theatrale Behauptung, das Als-ob, sich von der künstlerischen Autorität emanzipiert und eine soziale Dynamik schafft, die letztlich realweltliche Konsequenzen hat. Vor dem Hintergrund der Geschichte aktivistischen Theaters zeigt der Autor anhand der Aktionen rund um das Projekt deine-stele.de (2017) des Zentrums für Politische Schönheit und dem General Assembly (2017) von Milo Rau sowie des sogenannten ›Ibiza-Videos‹ (2019) exemplarisch, in welcher Weise aktivistische theatrale Strategien Kippmomente entstehen lassen, in denen Kunst und Politik sich wechselseitig verschalten.
Anna RaisichsBeitrag verhandelt mit Erster Europäischer Mauerfall (2014) ebenfalls eine Aktion des ZPS, richtet die Aufmerksamkeit allerdings einerseits auf den Diskurs, in dem die Aktionen des Kollektivs diskutiert werden, und andererseits auf die Bilder, die nicht Akzidens, sondern wesentlicher Bestandteil der Aktionen sind. Ausgehend von der ausführlichen Analyse eines Textes von Mely Kiyak zeigt Raisich, dass die Rezeption der Aktionen wesentlich mit der Grenzziehung zwischen Kunst und Politik operiert. Kiyaks Argument gegen die kritischen Pressestimmen beruht darauf, dass diese den Kunstwerk-Status schlicht verkennen und stattdessen lediglich über die Mittel, nicht aber über die Inhalte berichten, Kunstkritiker:innen so zu ahnungslosen Mitspielenden würden, die die eigene Position nicht verständen. Sie beruft sich dabei vor allem auf die Tatsache, dass die in der Aktion von Berlin an die europäischen Außengrenzen gebrachten Gedenkkreuze aus Werkstätten des Theaters stammen, sich somit also als bloße Mittel entpuppten. Mit Bruno Latour arbeitet Raisich jedoch heraus, wie sich diese Argumentation in eine ikonoklastische Tradition einordnet, die den Glauben an die vermeintlich leeren Symbole als naiv denunziert und in dieser entlarvenden Geste nicht zuletzt der eigenen Position Autorität verleiht. Stattdessen schlägt sie vor, die Bilder als Mediatoren zu verstehen, die weniger abbilden denn verbinden und über diese Verbindungen tatsächliche Wirkmächtigkeit erlangen. Entsprechend verfolgt der Beitrag den Weg dieser Bilder durch die Aktion hindurch und zeigt, wie in der Reise der Kreuze an die Außengrenzen Europas ein deutsches Gedächtnistheater erneuert wird, das koloniale Denkmuster und Rollenzuweisungen viel eher aufrechterhält als in Frage stellt.
Читать дальше