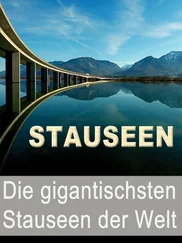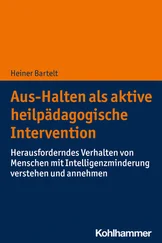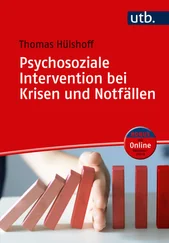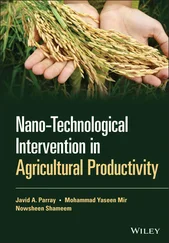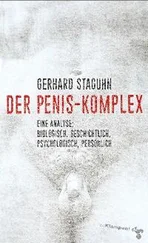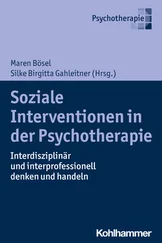Angesprochen sind damit aktivistische Kunstformen, die, wie im Portmanteau Artivismus deutlich angezeigt, eine wechselseitige Infizierung von Kunst und sozialer Aktion einfordern, aber auch der vielgestaltige Bereich von Kunst im öffentlichen Raum wie die unterschiedlichen künstlerischen Strategien der Subversion und Suspension einer weithin anerkannten symbolischen Ordnung. So fasst das Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst (2006) »Interventionismus und Aktivismus« 21 im gleichnamigen Eintrag auch zusammen und nennt das Aufbegehren gegen sexistische und rassistische Funktionsweisen kultureller Institutionen durch die Guerilla Girls oder die Plakataktionen des Kollektivs ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power), die »das homophobe Unbewusste der Staatsräson« 22 offenlegten, in den USA der 1980er Jahre als einschlägige Beispiele. Diese Szene aktivistischen Intervenierens in politische und soziale Kontexte, zu der im internationalen Spektrum sowohl die seit den 1990er Jahren in Österreich tätige WochenKlausur zu zählen ist wie die seit 2011 aktive feministische Punkrockband Pussy Riot oder die 2013 als Standing Man titulierte Protestaktion von Erdem Gündüz, agiert ihrem Selbstverständnis nach »mit konkreten Zielsetzungen« 23 und begreift künstlerisches Schaffen »nicht mehr als formale[n] Akt, sondern als Eingriff in unsere Gesellschaft« 24 . Eine etwas andere Facette des Wirkungsversprechens von direkten Eingriffen wiederum füllt das Spektrum der sogenannten »urbanen Intervention« 25 aus, die kritische Praxis zuallererst als Thematisierung von unterhinterfragten Wahrnehmungskonditionen des öffentlichen Raums ausübt und Städte als Einschreibungsorte architektonisch-künstlerischer Brechungen nutzt, dabei aber durchaus stadtplanerischen Marketingstrategien zuarbeiten kann.
Die Intervention kann sich also auch im Bereich der bildenden Kunst weder auf ein geschlossenes Konzept im Singular noch auf eine klar konturierte Theoriebildung berufen. Dass es sich bei der Intervention um einen »überverwendeten, aber unterbestimmten Begriff« 26 handelt, wie es im Untertitel des von Friedrich von Borries herausgegebenen Glossar der Interventionen heißt, liegt dabei nicht nur am heterogenen Ensemble von Ansprüchen auf Engagement, Transformation und impact , die er unter sich vereint. Widerstand gegen eine theoretisch und historisch konsistente Rahmung produziert die Interventionen inhärente Unterbrechungs- und Überschreitungslogik selbst.
Zentrale historische und ästhetische Anknüpfungspunkte für ein Verständnis sowohl von Kunst als sozialer Fuge (»social interstice « 27 ) wie als Produktion von Dissens und Modus der Verschiebung liefern insofern eine ganze Reihe von künstlerischen Praktiken aus den Bereichen der bildenden Kunst und der Performance seit den 1960er Jahren, die Widerstand gegen die Vorstellung vom geschlossenen Feld ›Kunst‹ und der Fokussierung auf ihre Objekte leisten wollten: Der Auszug aus den hermetischen Räumen der Kunst im Zuge der Land Art und die Entdeckung von Städten als Bühnen für skulpturale Eingriffe der Public Art ersetzten ein statisches und ortloses Betrachten von Kunstobjekten im vermeintlich neutralen White Cube 28 durch Konzepte des Ephemeren, des Unabgeschlossenen und der Ortsgebundenheit bzw. -spezifität. Bereits die dezidiert kapitalismuskritische Ereignisästhetik im Umfeld der Situationistischen Internationale (SI) entdeckte die Stadt als Ort, in den Spuren ästhetischen Handelns eingedrückt werden können. Die linksintellektuelle Bewegung um Guy Debord erprobte mit den Tätigkeiten des Dérive (zielloses Umherschweifen), des Détournement (Umlenken und -kontextualisieren von gegebenen Sinnzusammenhängen) und der Récupération (Rückaneignung der symbolischen Ordnung) eine Reihe an subversiven Gebrauchspraktiken urbaner Umwelt, die später ein breites Echo in den kommunikationsstörenden Techniken der Kommunikationsguerilla erfuhren.
Auch die aktivistisch grundierten Versuche der New Genre Public Art in den 1990er Jahren traten an, um einen Kontrapunkt zum unternehmerischen und apolitischen Ansatz der so bezeichneten Young British Artists um Damian Hurst zu setzen, und verpflichteten sich auf die ästhetische Kritik sozialer Handlungen. 29 Das Anliegen, neue Kommunikationsräume zwischen Menschen und ihren urbanen Lebensräumen zu stiften, ging unterdessen über den im Zuge von Kunst im öffentlichen Raum bereits vollzogenen Ausbruch des Künstlerischen aus den Institutionen erheblich hinaus. Als Exempel einer mittlerweile selbst historischen Entgrenzung der Künste »im Zeichen der unmittelbaren Verwandlung der Lebenswelt in den ästhetischen Schwebezustand« 30 legten sie den Fokus vom Kunstobjekt weg und stattdessen auf Prozessualität und Resonanz ästhetischer Kommunikation, um so die Ansprechbarkeit von Subjekten, das Affektgeschehen selbst ins Zentrum ihrer Aktionen zu rücken.
Mit Blick auf diese Tendenzen argumentierte Nicolas Bourriaud mit seinem Schlagwort der Ésthetique Relationelle (1998) für einen Paradigmenwechsel weg von der »assertion of an independent and private symbolic space« hin zu »human interactions and its social context« 31 . Als Exponent für dieses Kunstverständnis, das den Austausch zwischen Menschen als »everyday micro-utopias« 32 deklariert, dient dem Kunstkritiker u. a. der Künstler Rirkrit Tiravanija. Mit dessen Aktion Untitled (Free) (1992), die nicht mehr als eine Einladung zum Essen in die 303 Gallery in New York war, wo der Künstler seine Gäste bekochte, ging aus der Perspektive Bourriauds Begegnung, gesellschaftliche Öffnung und damit eine Gestaltung politischer Öffentlichkeit einher. Die Kritik an dieser Vision von Teilhabe und Austausch entzündete sich in der Folge vor allem an der antikonfrontativen Ästhetik wie an der Nobilitierung jeglichen Prinzips von Interaktion zu politischer Emanzipation. So wendet Claire Bishop im Rückgriff auf die radikaldemokratische Position Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes ein, 33 dass das Fehlen jeglicher antagonistischer Disposition zugunsten eines Austauschs von zwischenmenschlichen Gesten keineswegs dazu prädestiniert sei, gegenhegemonial zu wirken, sondern vielmehr für die Konstitution autoritärer Strukturen offen stehe. 34 Das von Bourriaud artikulierte Vertrauen in das ästhetisch-transformatorische Potential des Entgegenkommenden und Geteilten unterschlägt in diesem Sinn die Existenz eines substantiellen »Unvernehmens« 35 , das als Spannungsmoment jegliches Zwischen-Menschen-Sein prägt.
Die notwendige Pluralisierung von vorhandenen Perspektiven und die Diversifizierung von Teilnehmer:innen am Kunstgeschehen kann dabei verstärkt durch Gemeinschaften thematisiert werden, die Nancy Fraser in kritischer Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas als counterpublics bezeichnet hat, in denen »members of subordinated social groups invent and circulate counter discourse« 36 . Die Erkenntnis allerdings, dass selbst widerständige künstlerische Haltungen gegen dominante Repräsentationslogiken des Ästhetischen und Funktionsmechaniken der »Kunstwelt« 37 nicht zwangsläufig gegenhegemonial sein müssen, sondern wieder in institutionelle Selbstbefestigung rückübersetzbar sind, ging vor allem aus dem Betätigungsfeld der Institutional Critique in den späten 1980er Jahren hervor. Die damit aufgerufene Praxis des Intervenierens in die Konstitutionsbedingungen, Verfahrensweisen und Machtpolitiken von Kunstinstitutionen ist eng verbunden mit den Künstlerinnen Andrea Fraser, Louise Lawler und Martha Rosler. Hatten bereits Künstler wie Daniel Buren, Marcel Broodthaers und Hans Haacke in den 1960er und 1970er Jahren subversive Strategien entwickelt, um die ökonomischen Wertdiskurse des mächtigen Museumsdispositivs offenzulegen, so war die Institutionskritik der 1980er Jahre vor allem daran interessiert, das komplexe Netz von Bedingungen des Zustandekommens und Funktionierens des Kunstsystems zu analysieren und sich selbst in diesem Angriff nicht außen vor zu lassen. Die Institutionskritik basiert dabei nicht nur, wie Isabelle Graw darlegt, »auf der Grundannahme, Kunst könne etwas bewirken« 38 , sondern schreibt ihr ebenso »eine epistemologische Funktion« 39 zu. Die zentralen Operationsbegriffe der Recherche, Dokumentation und Analyse reagieren entsprechend auf diese Überzeugung.
Читать дальше