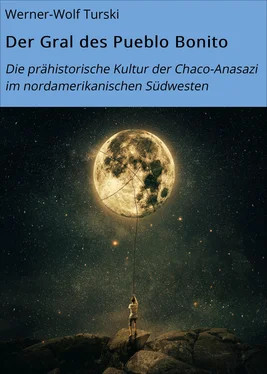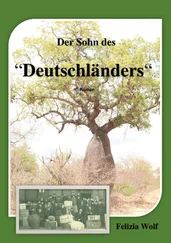Eine solche Stätte und ihr Umgebungsrevier, das Streif- und Beschaffungsrevier der diese Stätte nutzenden Menschengemeinschaft, kann nach einiger Nutzungszeit eine solche Bedeutung für die Gemeinschaft und eventuell auch für einige mit ihr interagierende Nachbargemeinschaften erlangt haben, dass für sonst ohne bauliche Anlagen praktizierte spirituelle Aktivitäten ein extra Raum geschaffen wird: das kann die Gestaltung eines „Tanzplatzes“/ plaza und/oder eines grubenhausähnlichen Bauwerks sein, das von den Archäologen in Analogie zu „ähnlichen“ Bauten der Hopi oder anderer heutiger Pueblo-Gruppen als Kiva bezeichnet wurde. Wenn die Größe der meist runden, seltener rechteckigen Kiva die der Wohnstätten wesentlich übersteigt, wird sie schon als Großkiva bezeichnet.
Zur Vorstellung der Qualität und Quantität dieser Niederlassungsdynamik muss man sich ein interaktives 3D-Modell über Raum und Zeit vorstellen, für dessen Gestaltung es heute dank entsprechender PC-Hard- und –Software gute technische Voraussetzungen gibt. Über dem betrachteten Verteilungsraum dieser oben genannten 200 Stätten sind 40 „Zeitscheiben“ a 15 Jahre (maximale Lebensdauer eines Grubenhauses) über 600 Jahre vorzustellen. In diesen Zeitscheiben werden die in dieser Zeit bestehenden Niederlassungen der Basketmker eingetragen. Nach 15 Jahren, d.h. in der nächstfolgenden Zeitscheibe sind diese Niederlassungen verschwunden oder bestehen weiter durch nachgewiesene „Neubauten“ auf früher bebauten Stätten/Nutzungsflächen oder durch Erstbebaung neuer/anderer Stätten/Nutzungsflächen. So geht es weiter über alle vorgegebenen 40 Zeitscheiben, die man dann modellhaft (Typ Daumenkino) „durchblättern“ kann.
Jede Zeitscheibe ist entsprechend der Dendrochronologie mit der jahresdurchschnittlichen oder jahresscheibendurchschnittlichen Niederschlagsmenge („farblich“) zu markieren. Einsprechend der Topographie der betrachteten Fläche sind Zonen erhöhter oder geringerer Feuchtigkeit/Durchnässung nach ihrem Wasserhaltevermögen zu kennzeichnen. Damit erkennt man, in Abhängigkeit vom Untergrund (Bodenverhältnisse), die Bereiche höherer und geringerer biologischer floraler und faunaler Produktivität, die von den wandernden/mobilen Basketmakern zum Sammeln und Bejagen genutzt wurden. Um jeden Standort/jede Stätte ist eine „Reviermarkierung“ anzulegen (Radius: ein, zwei, fünf und zehn Tagesmärsche unter Beachtung der Topographie). Diese Reviere müssen das nutzbare Nahrungsstoffpotenzial für diese Haushaltsgruppe enthalten. Dass sich die konstruierten Reviergrenzen verschiedener Haushaltsgruppen überschneiden, ist dabei völlig normal - Überschneidungszonen sind potenzielle Kontakt- und Kommunikationenzonen/Interaktionsbereiche. Im Stätten-Umkreisen mit einem Radius von 3 bis 5 km sind auch Flächen zu markieren, die für bodenbauerische und/oder spezialsammlerische Aktivitäten potenziell ergiebig gewesen sein könnten. Spezialsammlerische Aktivitäten beinhalten Maßnahmen, die die biologische Produktivität von durch Menschen genutzten Wildpflanzen steigern (= Erntevölker“) wie z.B. Wasserabflussbremsen/Dämme im Wasserabflusslauf, Verteilung abfließender Wässer, Erosionsschutz, Beseitigung konkurrierender Vegetation (Abbrennen), Aufbau von Steinstapeln u.ä.
Die digitale Gestaltung eines solchen interaktiven Modells (auch über den hier geschilderten Rahmen hinaus) stellt softwareseitig heute kein Problem mehr dar, das Handicap ist aber der oft unzureichende wissenschaftliche Datenfundus, der nur teilweise hypothetisch ausgefüllt werden kann. Für die Leserin/den Leser muss deshalb die obige Beschreibung genügen.
Der Mensch praktiziert zwei Formen des persönlichen Energiemanagements: die aktive Form durch Aufnahme/Einnahme und Verdauung/Verarbeitung von Energieträgern (Nahrungsstoffe) und –verteilern (Wasser) und die passive Form durch Vermeidung von Körperenergieverlusten mittels Kleidung und Schutzräumen. Die Energiezuführung musste mit den Energieverbrauch weitgehend ausgeglichen sein, sonst droht der Exitus.
Irgendwann waren die Kenntnisse des Menschen über sein (relativ oft und dauerhadft durchstreiftes) Revier und dessen Quanität, Qualität und temporäre Zuverlässigkeit der Nahrungsstoffpotenziale zu einer ausreichend feststehenden, „berechenbaren“ Größe geworden, um zu dem Schluss zu kommen, dass man die Schutzbauten an Standorten, die man über den Winter bewohnt, auf Grund einer wiederholten Nutzung gegen den „starken Feind Kälte“ wirtschaftlich berechtigt mit einem größeren Arbeitsaufwand stabiler, winddichter, isolierender bauen kann. Die wiederholte Nutzung des Ortes und die Größe des „Feindes“ rechtfertigten den erhöhten Aufwand für den Hüttenbau, den Bau der Erdhütte, des Grubenhauses.
Die ersten Grubenhäuser (0,2 bis 0,3 m eingetieft, Durchmesser: 3,5 bis 4,0 m) hatten eine Dachüberdeckung aus Holzwerk. Dies bestand aus auf vier Stammsstützen/Pfosten, auf die ein Viereck-Pfostenrahmen aufgelegt und mit den Stützpfosten durch Anbindung verbunden worden war. Vom Rand der Grube wurden dicht an dicht Holzpfosten so auf den Rahmen gelegt, dass in der Mitte eine Dachöffnung (als Rauchabzug, später zum Einstieg) verblieb. Der Einstieg in das Grubenhaus erfolgte, nach dem Überschreiten dessen Dachfläche, über eine einfache Stammleiter, später auch über eine Rungenleiter. Das Dach musste für die Abdeckarbeiten und zum Leiterzugang trittsicher gestaltet sein. Die Dachpfostenschicht wurde mit Rinde, Gras oder Matten flächig abgedeckt und mit einer Schlammschicht/Adobe wind- und regendicht überzogen. Die inneren, überdeckten Seitenwände waren glatte Erdflächen und der unbearbeitete Boden war durch Nutzung festgetreten. In der Mitte des Fußbodens war der Platz für eine kleine Feuerstätte. Ältere Grubenhausversionen hatten noch einen Seiteneingang und das Dach wies nur die Rauchabzugsöffnung auf, die erst später zum Eingang gestaltet wurde. Diese Behausung war kaum mehr als eine Schutzstätte bei ungünstigem Wetter und meist nur zum Schlafen/Ruhen und möglicherweise zum Kommunizieren (Winterabenderzählungen) geeignet. Alle Arbeiten und sonstigen Aktivitäten erfolgten im Freien.
Das einfach geformte Bauwerk Grubenhaus wurde im Laufe der nächsten 500 bis 700 Jahre im gesamten Gebiet des Colorado Plateaus mit lokal leicht unterschiedlichen Modifikationen von den Weibern zu immer „luxuriöseren“ Wohn- und Sakralbauten zunehmend „wohnlicher“ gestaltet – ab 700 u.Z. neben den entstehenden übertägigen Mauerwerksbauten. Die immer „luxuriösere“ Ausstattung war von den unmittelbaren Lebensbedürfnissen der Nutzer/Bewohner/Errichter geprägt und nicht von irgendeinem „abgehobenen“ Repräsentationsbedürfnis einer „führenden“ Person. Ein Grubenhaus hatte je nach der Art seines (mehr oder minder geschützten) Standortes und der permanenten Instandhaltung oder der eventuell saisonalen Instandsetzung eine Lebensdauer um 15 Jahre. Neue Grubenhäuser wurden teilweise über den Standorten von alten errichtet (Man sparte dabei einen Teil der Erdaushubarbeiten. Verrottetes Altholz diente nur noch für Feuerungszwecke. Wenn Holz von einem alten Grubenhaus noch nutzbar war, wurde es im neuen Bauwerk mit verwendet/eingebaut (Sekundärrohstoffnutzung). Das „erfreut“ heute die Archäologen, die damit ihre Datierungen vornehmen.
Man sollte sich beim „Ausmalen“ solcher Bauaktivitäten stets die hölzernen und steinernen Werkzeuge für die Holzgewinnung und die Zurichtung der Pfosten und die Grabarbeiten vergegenwärtigen. Inwieweit immer grünes Frischholz gefällt wurde und zum Einsatz kam, lassen Archäologen aus ihren Betrachtungen heraus, sonst stünden Datierungsmethoden zumindest bezüglich ihrer Genauigkeit in Frage, da der letzte äußere Baumring als das Fälldatung und quasi Nutzungsbeginn des Holzes (im Bauwerk) gilt. (Die Nutzung von idealen „Lagerstätten“ angespülter Schwemmhölzer – wofür nur an wenigen Stellen auf dem Colorado Plateau ein Potenzial bestandr - brachte für die Baumring-Datierungsaufgaben der Archäologen erhebliche Probleme - bis man die Ursachen der Probleme erkannte.
Читать дальше