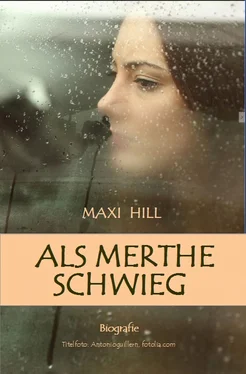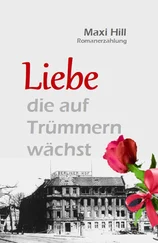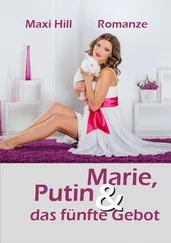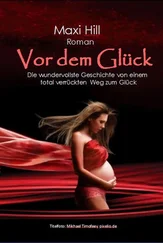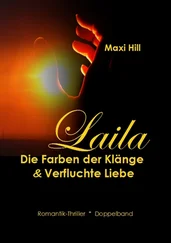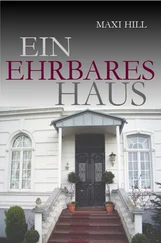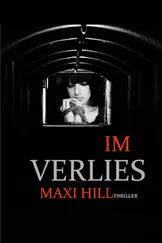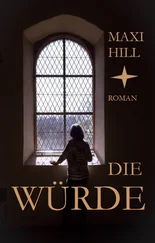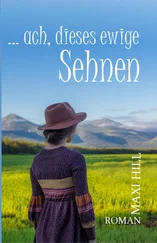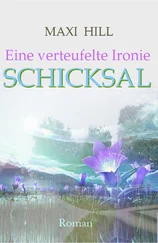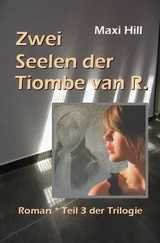Die Straße verläuft im großen Bogen um den Bahnhof herum. Ist sie zu Fuß unterwegs, springt sie zumeist flugs über die Gleise – verbotenerweise.
Heute hat sie das Fahrrad genommen, obwohl der Berg doch wieder abzusteigen gebietet. Während ihre Füße kraftvoll in die Pedale treten, ringt Toni nach Luft und die Kette möchte bei jeder Umdrehung dem Zahnrad ihren Dienst versagen. Auf halber Höhe, hier, wo Oma Maria einst wohnte, steigt sie ab. Wie immer freut sie sich auf die Schussfahrt zurück, wenn nur die schweren Taschen nicht das Lenken unmöglich machen.
An der Einbiegung steht eine Frau mit einem Netz hell leuchtender Frühkartoffeln. Sie hatten unlängst davon geredet, die Einkellerungskartoffeln müssten bestellt werden. Also nicht geradeaus zum großen KONSUM, sondern nach rechts zum kleinen Privathändler.
Gerade biegt sie ein in die kleine Bahnhofstraße, die ihr Abkürzung bedeutet, als auf der großen Bahnhofstraße ein dunkelgrüner Lastwagen mit dem weißen Zeichen CA angedonnert kommt und waghalsig die Kurve nimmt. CA - Sowjetarmee. Vielleicht wird Iwan jetzt abgelöst, denkt sie. Iwan und sein Genosse Jewgeni können nicht Deutsch, aber Toni kann nach fünf Jahren Unterricht ein wenig Russisch. Die beiden blutjungen Muschkoten in schweren Knobelbechern, mit harten Koppeln um die Hüften, mit Schweißrändern an senfgelben Blousons unter dicken Lodenmänteln, mit schrägen Käppis auf fast haarlosem Kopf und mit dem Gewehr über der Schulter, diese Jungen haben ungefähr ihr Alter und sie tun ihr leid. Doch diesmal sticht ein Gedanke schärfer in ihrer Seele.
Was hat Mama gegen diese armen Kerle, die auf freiem Feld bei Wind und Wetter, wie bei brütender Hitze, schon ein paar Tage vergessen an der Kreuzung herumlungern. Freilich werden sie hin und wieder einem Fahrzeug den Weg zum Manöverplatz weisen. Aber was essen und trinken die beiden und wo schlafen sie?
Die kleinen Häuser links und rechts der Straße hat sie hinter sich gelassen. Die meisten der Leute, denen die Häuser gehören, kennt sie nicht, nur eines glaubt sie noch immer: Wer ein Haus besitzt, ist reich.
Auf freier Strecke zwischen den Feldern riecht es nach verbrannten Erbsen mit Speck. Sie weiß, es ist das Gas aus dem Gasometer der Fabrik, deren Schornsteine rechtsseitig das Wäldchen überragen. Dort werden die Tunnelöfen mit Gas beheizt, um das Porzellan brennen zu können. Von einem Rundofen spricht ihre Mutter bisweilen. Toni kennt die Fabrik nur vom Schlagbaum her, wo sie als Kind sehnsuchtsvoll stand, die Zeiger der großen Uhr am Bürohaus verfolgte, die Sekunden mitzählte, bis die Sirene erklang. Aber Merthe Jacob kam immer sehr spät, später als die meisten heimwärts Hastenden. Damals hat sie diesen Geruch nicht gespürt. Er zieht nur bei nordwestlichem Wind hier herüber und steigt auf in die Höhe dieses Hügels. So wie sie die Nase in den Wind hält, fällt ihr ein ähnlich rauchiger Geruch ein:
Sie war noch sehr klein, als ein Russe zu Hause im breiten Rahmen der dunklen Küchentür stand. Er hielt zwei Laibe Brot in den Händen und eine ganze Wurst. Der Mann mit dem breiten, freundlichen Gesicht hatte seine Mütze weit aus der Stirn geschoben. Die rote Litze am oberen Rand lag wie ein Heiligenschein hinter seinem Kopf. Er strahlte über das rötliche Gesicht und sang ein paar Worte, die sie nicht verstand. Diese Wurst aber roch ähnlich rauchig, wie das Gas der Fabrik an manchen Tagen riecht. Ob es russische Wurst war? Man sagt, die Russen auf der Kommandantur bestimmten damals das gesamte Leben. Also waren es Brote vom hiesigen Bäcker und die Wurst von einem der zwei Fleischer, die das Dorf damals hatte. Die Russen, denen man in den Schulbüchern die Gerechtigkeit auf den Leib geschneidert hat, könnten es für die Hungernden konfisziert haben. Warum aber bekam nicht jeder seine Ration? Es hungerten alle Menschen. Fast alle. Dass diese Ration außergewöhnlich war, ahnt Toni, weil die Mutter den größeren Geschwistern eingeredet hatte, sie dürfen niemandem davon erzählen, nichts von dem Soldaten und nichts von den Broten und der Wurst.
Viel später erst hatte ihre Schwester Elfi die alte Kutzer sagen hören: Die Russen mögen uns Alte nicht, sie mögen nur junge Frauen und kleine Kinder.
»Mein je«, soll ihre Mutter sich erbost haben. »Ich hab΄ fünf hungrige Mäuler, und wie die sich freuen, einmal satt zu werden!«
Warum denkt sie nicht mehr an diese noble Geste eines Besatzers? Auch wenn die Leute Angst vor den Russen hatten, dieser sah fröhlich aus. Das wenigstens weiß Toni noch. Aber fröhlich von Gemüt? Oder froh gelaunt von »цто грам« – hundert Gramm, wie man zu einem gut gefüllten Glas Wodka sagte? Was weiß ein Kind über den Grund für ein aufgekratztes Mannsbild?
Viele Körnchen Erinnerung fliegen durch ihren Kopf. Zu einem Bild werden sie nicht, sie bleiben in Unordnung:
Da muss noch mehr sein, was Mama bis heute nicht vergessen kann.
Nun bedient man sich der Logik, wenn man keine Bücher hat, die einem die Klarheit bringen können. Eine Logik findet sie nicht, und in keinem ihrer Lehrbücher hat sie gelesen, was Menschen in Erstarrung versetzt, wenn sie das Wort Russen hören. Geschichtsbücher sprechen stets von einem heroischen Volk. Alles Mögliche hat sie gelesen, weniges hinterfragt, das meiste hingenommen aus der geltenden Meinung. In all den Filmen, die sie gesehen hat, war der Russe ein friedlicher Mensch mit viel Gastfreundschaft, mit großer Nächstenliebe und ohne Eigennutz.
Seit diesem Tag ist sie aufgeschreckt, will mehr erfahren über die Zeit nach der »Endzeit«, wie die Alten den Untergang ihres einstigen Reiches nennen. Sie nicht nur das Angenehme wissen, auch die herben Seiten der Sache sind ihr wichtig.
Die Händlerin fragt nach Merthe, und etwas von Anerkennung liegt in ihrem Blick. Vielleicht hat Toni ihren Entschluss, in Zukunft mehr mit den Menschen zu reden, erst in diesem Moment gefasst. Vielleicht aber lag die Absicht, über ihre Mutter zu reden, die ganze Zeit vor ihr, die sie sich abgemüht hatte, die hügelige Seitenstraße zu nehmen, ohne abzusteigen.
Die Händlerin kennt Merthe gut, und sie kennt auch Toni. Sie war es, die vor Jahren immer zum Einkaufen geschickt wurde, wenn kein Geld im Hause war und wenn angeschrieben werden musste. Toni weiß nicht mehr, wie sie sich dabei gefühlt hat, aber sie weiß noch, wie sie sich für die Schlepperei mit angeknabbertem Brot, mit ausgebrochenen und roh verspeisten Blumenkohlröschen, zuweilen auch mit abgeschleckter Sahne aus der Milchkanne gerächt hat. Mama hat es großmütig übersehen. Ihr war das allemal lieber, als die Scham der Armut ertragen zu müssen.
Noch immer stehen die Glasballone auf dem Ladentisch aufgereiht, die sie als Kind so sehnsuchtsvoll betrachtet hat. Himbeerbonbons, Schaumstücke und der Bruch von Karamelle. Nur sehr selten standen Süßigkeiten auf ihrem Einkaufszettel. Die kinderreiche Kriegswitwe Merthe Jacob brauchte die Zuckermarken zum Tausch gegen gebrauchte Kleidung, die den Kindern anderer Leute nicht mehr passte oder nicht mehr gut genug war. Toni profitierte am meisten davon. Elfi trug die Sachen von Rica ab, bis sie – mehrmals aufgetrennt und die Teile gewendet und wieder zusammengenäht - nicht mehr zu gebrauchen waren. Und Heiner, der einzige Junge, bekam hin und wieder etwas von seiner Patentante Adda, die eigentlich Marie Hering hieß. (Weil aber Heiner das Wort Tante nicht sagen konnte, blieb sie von nun an für alle die Adda.)
Damals hatte Adda im Sechs-Familien-Haus als einzige Frau das Privileg, keine Kriegswitwe zu sein. Zwar hatte sie einen Sohn verloren, aber seit Heiner auf der Welt war, diente er als Ersatz für Addas überschüssige Mutterliebe.
Solange Toni denken kann, war Inga, die älteste Schwester, schon aus dem Haus und arbeitete bei Neschwitz auf einem Bauernhof – in Stellung. Diese Arbeit junger Mädchen in fremden Haushalten grenzte zuweilen an Leibeigenschaft, gegen die dennoch niemand aufbegehrte.
Читать дальше