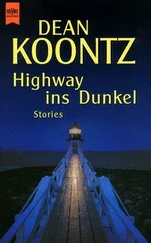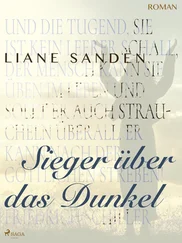Frau Meyr riss mich aus meinen Gedanken. Unbemerkt war sie wieder neben mich getreten, einen jungen Mann mit einem Rucksack an ihrer Seite.
„Herr Neuer, das hier ist Haitham.“, stellte sie mir ihren Begleiter vor.
„Hallo Haitham, ich bin Philip.“ Wir gaben uns die Hand. Abwartend. Vorsichtig. Wie scheue Tiere, die sich erst einmal beschnuppern müssen. Als könnten wir einander durch einen simplen Händedruck verletzen.
„Danke, Philip“, sagte Haitham schließlich leise. Ich lächelte ihm aufmunternd zu.
„Dann wollen wir mal!“, sagte Frau Meyr fröhlich, bevor sich ein unangenehmes Schweigen zwischen uns beiden ausbreiten konnte. Also schulterte Haitham seinen Rucksack und wir liefen hinter Frau Meyr her in Richtung meiner Wohnung. Auf dem Weg dorthin hatte ich Zeit, mir meinen neuen Mitbewohner ein wenig genauer anzuschauen: Haitham musste Mitte 20 sein, also jünger als ich mit meinen 32 Jahren. Seine dunkle Jeans und das karierte Hemd, das er an den Armen hochgekrempelt hatte, ließen eine sportliche Figur vermuten. Seine dunklen Augen, die sich hinter einer dunkel gerahmten Brille versteckten, hatten einen aufmerksamen, fast etwas gehetzten Blick. Auf seinem Kopf kräuselten sich schwarze Locken. Den ganzen Weg lang umspielte ein leichtes Lächeln seine Lippen, das mir den Großteil meiner Zweifel nahm. Es wird schon klappen, sprach ich mir selbst Mut zu.
Zu Hause angekommen zog Frau Meyr sich diskret in die Küche zurück, damit ich Haitham als Allererstes ungestört sein Zimmer zeigen konnte. Der freie Raum in meiner Wohnung war spärlich eingerichtet worden, aber sollte alles Nötige bieten. Erst jetzt fiel mir auf, dass mein neuer Mitbewohner ja nichts als einen großen Rucksack mitgebracht hatte, sodass mir das Zimmer auf einmal wirklich karg vorkam. „Es ist nichts Besonderes“, entschuldigte ich mich. „Wir können ein wenig Deko kaufen oder schauen, ob Dir sonst etwas fehlt.“
Energisch schüttelte mein neuer Mitbewohner den Kopf: „Das hier ist Paradies!“, erwiderte er energisch mit einem leichten Akzent, und fügte dann wieder leiser hinzu: „Danke, Philip.“
„Jaja, ist gut jetzt“, winkte ich ab und klang dabei ein wenig resoluter als ich es eigentlich wollte. Diese riesige Dankbarkeit hatte ich nicht erwartet, und die Situation war mir nun doch ein wenig unangenehm. Zumal ich vor dem Wohnheim ja in der Tat noch kurz darüber nachgedacht hatte, mich auf dem Absatz umzudrehen und davon zu laufen. Durch das Leuchten in Haithams Augen fühlte ich mich jetzt schlecht dafür. Damit ich nicht noch weiter ins Grübeln kommen konnte, berührte ich ihn kurz am Arm und sagte: „Komm, ich zeig Dir den Rest der Wohnung.“
Betti
Ich habe Papa nie gefragt, wie er das sah, aber als die Phasen, in denen meine Mutter im Bett lag, vor sich hin weinte und kaum etwas aß, zunahmen, wünschte ich mir fast die jähzornige Frau zurück, die Sachen durch die Gegend warf und unzusammenhängende Sätze auf Italienisch schrie. Zu dieser Zeit war uns beiden längst klar, dass dieses Verhalten, das sie an den Tag legte, alles andere als normal war.
Als ich eines Tages aus der Schule nach Hause kam, stand unser Hausarzt an Mamas Bett und packte gerade die Spritze wieder ein, die er ihr offensichtlich gerade verpasst hatte. Mein Papa, der auf der anderen Seite des Bettes stand, hatte einen besorgten Ausdruck auf dem Gesicht. Ich blieb im Flur stehen und traute mich nicht so richtig, zu den Erwachsenen zu stoßen. In mein Zimmer gehen wollte ich aber auch nicht. Was war los mit meiner Mama? Ich schnappte die Worte „Zusammenbruch“ und „Antidepressivum“ auf, Worte, die ich nicht verstand, aber sie klangen gefährlich. Um mehr hören zu können, ging ich einen Schritt in Richtung Schlafzimmer. Leider entdeckte mein Vater mich in diesem Moment, ging mit einem ernsten Blick auf mich zu und schloss die Tür von innen, sodass ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, zu lauschen. Frustriert machte ich mich auf in mein Zimmer, wo ich vor mich hinstarrte. An meine Hausaufgaben konnte ich nun wirklich nicht denken. Aber etwas Anderes konnte ich gerade auch nicht tun. Also kramte ich seufzend in meiner Tasche nach meinen Büchern und versuchte es wenigstens, bis ich später die Haustür gehen hörte. Der Arzt schien gegangen zu sein.
„Was ist mit Mama?“, fragte ich Papa beim Abendessen. Über Marias Zustand zu sprechen war eigentlich ein Tabuthema für uns zwei. Mein Vater und ich hatten während der Phasen, in denen meine Mutter kaum aus dem Bett aufstehen konnte, eine traurige Routine entwickelt: Wenn ich aus der Schule nach Hause kam, hatte Papa schon Mittagessen gekocht und versucht, Mama zum Essen zu bewegen. Wir beide aßen gemeinsam am Tisch, überwiegend schweigsam. Ich erzählte kurz von der Schule, Papa berichtete ein wenig von seiner Schicht letzte Nacht oder richtete Grüße von meinen Großeltern aus. Oft kochte auch Nonna für uns, wenn Papa mittags ins Lokal musste oder zum Einkaufen unterwegs war. Nachmittags erledigte ich meine Hausaufgaben. Abends kümmerte ich mich in der Regel um Mama, da Papa nun fast immer arbeiten musste und Nonna nicht da war. Nonno ging es immer schlechter, sodass mein Vater in der Küche des Restaurants die Führung übernahm. Meistens schmierte ich ein paar Brote oder wärmte Reste vom Mittagessen auf. Wenn Mama nicht gerade schlief, erzählte ich ihr von meinem Tag oder las ihr ein paar Seiten vor. Ich kämmte ihre Haare, die von ihrem Kopf abstanden wie ein großes Vogelnest. Anschließend fiel ich selbst ins Bett, wo ich dann aus Gewohnheit noch meinen Schokoriegel aß, bevor dann auch ich einschlief. Manchmal hörte ich nachts die Wohnungstür gehen, wenn Papa von der Arbeit nach Hause kam. Dann hörte ich, wie sich die Tür zu meinem Zimmer leise öffnete und er den Kopf reinsteckte, um nach mir zu sehen. Ich stellte mich schlafend, damit er sich keine Sorgen machte, dass ich noch wach im Bett lag. Doch oft schlief ich in der Tat einfach durch und hörte ihn erst gar nicht, bis morgens der Wecker klingelte. Dann begann der ganze Kreislauf von vorn.
Ob ich nachmittags nach den Hausaufgaben vor die Tür kam, hing davon ab, wie viel Aufmerksamkeit meine Mutter forderte. Freunde hatte ich nicht wirklich. Von Natur aus war ich eher still und zurückhaltend wie mein Vater. Hinzu kam die Situation zu Hause: Ich wusste, dass das, was wir erlebten, nicht der Normalität entsprach. Was sich in unseren Wänden abspielte, ist nichts, mit dem man hausieren geht. Also sprach ich nicht darüber. Da die Pflege meiner Mutter während dieser Phasen allerdings mehr oder weniger meinen kompletten Alltag bestimmte, gab es nicht viel Anderes, über das ich reden konnte. Also ließ ich es einfach. In der Schule war ich nicht schlecht, aber durch die Sorge um meine Mutter vollbrachte ich natürlich auch keine Höchstleistungen.
Nach einiger Zeit waren mein Vater und ich, wie gesagt, recht gut aufeinander eingespielt. Wie lange wir so nebeneinander her lebten, kann ich gar nicht so genau sagen. Immerhin gab es zwischendurch ja auch immer wieder Momente, in denen meine Mutter ganz normal am Leben teilnahm, als hätte es diese Episoden vorher nie gegeben. Auch Papa und ich taten dann einfach so, als wäre nichts gewesen. Der Arztbesuch an jenem Tag hatte unsere Routine jedoch durchbrochen und Papa saß mit mir beim Abendessen. Ins Restaurant wollte er erst später. Deswegen hatte ich mir nun ein Herz gefasst und sprach Papa auf Marias Zustand an.
„Was ist mit Mama?“, fragte ich also.
Papa sah von seinem Brot auf und zog die Augenbrauen nach oben. Mit diesem Tabubruch hatte er wohl nicht gerechnet.
„Was soll mit ihr sein?“, versuchte er der Frage auszuweichen. Aber ich war mittlerweile schon 15 Jahre alt. In diesem Alter verlangt man Antworten und lässt sich nicht mehr einfach so abspeisen. Vielleicht war es auch der erste vorsichtige Akt der Rebellion eines pubertierenden Teenagers, der mich weiterfragen ließ.
Читать дальше