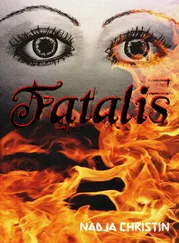Ich flüchtete mich in meine Gedanken und Erinnerungen, nur weg von dem hasserfüllten Blick, der immer noch vor meinem inneren Auge umher tanzte. Nur weg von der Wirklichkeit, hinein in die tröstliche Wolke und die Zeit ein paar Jahre zurückdrehen. In eine Zeit eintauchen, als es noch keinen Justin gab, noch keinen Frank und noch keine Vampire, jedenfalls für mich noch nicht.
Einige Stunden verbrachte ich am Fuße der Straßenlaterne und ließ meine Selbstheilungskräfte für mich arbeiten.
Ich stand auf und bewegte meinen Hals vorsichtig hin und her. Es ging wieder. Gleich würde es hell werden, ich musste schnell sein.
Ich rannte zu meinem alten Haus, die Stufen zur Eingangstür hoch und stand vor der offenen Tür.
Blutgeruch stieg mir in die Nase, ich schloss kurz die Augen. »Nein!«, es war nur ein Hauch.
»Oh nein, er hat es doch wahr gemacht.«
Zögernd ging ich in den Flur. Rechts war die Küche, aber der Geruch kam von oben. Langsam stieg ich die Treppen empor, Stufe um Stufe kostete mich mehr Kraft. Oben angekommen verharrte ich kurz. Ich musste mich orientieren, hier war ein Geruch, den ich nicht kannte. Er kam von rechts, ich ging ihm nach. Die Tür vor mir war nur angelehnt, mit einer Hand stieß ich sie auf.
Da lag sie vor mir, im Badezimmer, eine hübsche Frau, braune Haare und sehr schlank. Vielleicht vierzig Jahre alt. Ich blickte sie an und legte meine Stirn in Falten, ich überlegte, wer sie war und ob ich sie schon mal gesehen hatte.
Klar, er hatte wieder geheiratet, schoss es mir durch den Kopf. Er konnte zwei so kleine Kinder ja nicht ohne Mutter aufwachsen lassen. Ich betrachtete sie genauer. Ihr Gesicht war kalkweiß und schmerzverzerrt, an ihrem Hals prangten zwei Einstichstellen. Wie in Trance drehte ich mich um und folgte den bekannteren Gerüchen. Im Schlafzimmer fand ich meinen Mann, er lag noch auf dem Bett, auf dem Bauch. Ich stellte mich neben ihn, damit ich sein Gesicht sehen konnte. Er war in den letzten Jahren kaum gealtert, eigentlich sah er noch genauso aus, wie früher.
Ich drehte mich um und ging zum Kinderzimmer. Auch hier war die Tür nur angelehnt. Es war, als sollte ich sie alle so finden, kein Mörder machte sich die Mühe, die Türen sorgfältig anzulehnen. Er knallte sie nach der Tat entweder zu, oder ließ sie einfach offen stehen. Was erwartete mich hier, fragte ich mich. Der Blutgeruch war überwältigend. Zögernd hob ich meine Hand und stieß die Tür auf.
Es war früher schon ihr Zimmer. Nach Osten raus, weil sie den Sonnenaufgang so geliebt hat. Sie lehnte gerne verträumt am Fenster und sah den Sonnenstrahlen zu, wie sie langsam die Wände berührten und sich an ihr entlang tasteten.
Auch jetzt ging gerade die Sonne auf, ihre Strahlen trafen auf die gegenüberliegende Seite, malten ein bizarres Schattenspiel auf die weiße Wand.
Dazwischen hing meine Tochter.
An den Handgelenken mit Seilen aufgehängt, aufgeknüpft wie ein Stück Vieh. Ihr Kopf war nach vorne geneigt, ihr langes, blondes Haar verbarg ihr Gesicht. In dem Blond der Haare waren rote, fast rostige Stellen. Sie sahen aus, wie blutige Strähnchen. Sie hatte ein weißes Nachthemd an, mit kleinen rosa Blümchen drauf. Überall waren Blutflecken und Spritzer. Selbst an der Decke über ihrem Kopf. Ihre Füße waren nackt, sie schwangen ganz sachte hin und her.
Auf ihrem Nachthemd war ein breiter roter Streifen zu sehen, er führte bis unten hin zum Saum. Es war das Blut, das aus ihrer Halswunde geflossen war. Dennis hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie auszusaugen, er hatte sie gebissen und die Wunde offen gelassen, damit sie langsam verblutete.
Ein dicker Tropfen lief unter dem Saum ihres Nachthemdes hervor, floss über ihren Fuß, bis zum Zeh. Dort sammelte er sich und wurde dicker, bis er sich schließlich löste und fiel.
Ich verfolge diesen Tropfen mit den Augen, sah wie er sich durch den Luftzug verformte. Bis er unten auftraf. Ein leises Plitsch ertönte, als der Tropfen sich mit den unzähligen anderen Tropfen, die unter ihren Füßen eine Lache gebildet hatten, vereinte. Es spritzte leicht, aber nur ein bisschen.
Das war mein Stichwort.
»NEIN!« Es war das Einzige, was ich zu brüllen in der Lage war.
Ich stand da, blickte meine tote Tochter an und brüllte mein Entsetzen, meine Wut und meine Trauer hinaus.
Ich konnte nicht weinen, ich bedauerte das zutiefst. Ich mochte weinen, damit die Tränen meine Gefühle weg spülten. Diese unerträglichen Gefühle, die meinen Körper von innen her zu zerreißen drohten.
Die wie Tischtennisbälle in meinem Inneren unkontrolliert hin und her sprangen. Bis an die Grenzen meines Seins, meines Daseins.
Ich wollte weinen können.
Damit ich sie nicht in mir drin behalten musste.
Irgendetwas in mir zerriss. Zersprang mit einem scharfen, klirrenden Geräusch.
Ich schloss meinen Mund und drehte mich abrupt um.
Ich musste hier weg.
Ich lief die Treppen hinunter und stand wieder vor dem Haus. Aus den Augenwinkeln sah ich die Nachbarn neugierig aus ihren Häusern kommen. Ich rannte schnell die Straße entlang, es war mir egal, ob mich einer der Blutsäcke sah. Ich lief durch den Wald, den gleichen Weg, den ich vor ein paar Stunden schon mal gerannt war, nur in die andere Richtung. Da hatte ich allerdings Justin vor mir, ich versuchte ihn zu erreichen, ihn zu stoppen. Da hatte ich Panik in mir, und Hass. Hass auf meinen Sohn Dennis.
Genau das gleiche Gefühl hatte ich jetzt auch wieder.
Blanker, purer, bösartiger und tiefster Hass.
Aber es war wenigstens ein Gefühl. Ein Gefühl, das ich kannte, dem ich vertrauen konnte und für immer in mir behalten wollte.
Ich rannte weiter und weiter aber eine vertraute, rote Wolke war schneller, sie hüllte mich ein, saugte mich auf, nahm mich mit in ihre dunklen, tiefen und fast schon tröstlichen Abgründe. Zog mich in ihren Strudel hinein. Ließ mich darin versinken und ertrinken.
Ich wünschte mir …
Ich wünschte mir sehnlichst …
Ich wünschte mir sehnlichst, daraus nie wieder aufzutauchen.
Es war kalt, sehr kalt. Der Mond stand voll und groß am Himmel, umgeben von tausend glühenden Punkten.
Ich stand auf den äußersten Zinnen der Stadtmauer. Meine Füße standen eng nebeneinander auf dem bröckeligen Gestein der alten Mauer. Ich verhielt mich ganz still. Der Wind wehte kräftig um mich herum und versuchte mich von den Zinnen zu reißen. Meine Augen waren geschlossen, der Kopf in den Nacken gelegt. Meine Arme ausgebreitet, so stand ich dort oben und wartete auf den Geruch.
Ich erwartete keinen bestimmten Duft, ich würde mich spontan entscheiden. Entscheiden wer von den Menschen es wert sei zu sterben, durch mich zu sterben.
Es ist März, das letzte Jahr war nur noch ein blutiger, wilder Sturm in meiner Erinnerung. Ein Sturm voller Qualen, Gier und Mordlust und … voller Blut.
Sehr selten gestattete ich mir, in dem roten Strudel der Erinnerung zu versinken. Zu schmerzlich waren die Gedanken an den letzten Sommer.
Ich habe gekämpft und ich wurde besiegt, ich habe verloren, alles verloren.
Mein Dasein wird nie wieder so sein wie früher, ich bin nicht mehr die Gleiche. Meine äußeren Wunden waren verheilt, aber innerlich war etwas zerrissen, das nicht heilen würde.
Niemals, es war zerstört. Unwiderruflich.
Ich bewegte mich nicht mehr unter den Menschen, hielt mich Abseits. Trat nur noch mit ihnen in Kontakt, wenn ich einen von ihnen töten wollte. Dann war ich schnell, brutal und grausam. Dann war ich ein Raubtier.
Das Raubtier, das dem Monster Nahrung geben musste, weil es danach verlangte und erst wieder Ruhe einkehrte, wenn das Monster gesättigt war.
Nach den Vorfällen im August war ich zu Josh geflüchtet und hatte mich meinem Schmerz und meiner Wut hingegeben. Ich war tagelang nicht ansprechbar, hatte in Joshs Keller gewütet und geschrien, versuchte mein inneres Monster zu bekämpfen, es einfach verhungern zu lassen.
Читать дальше