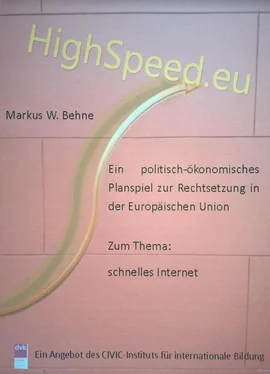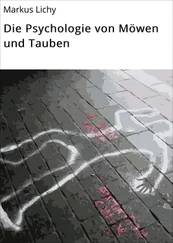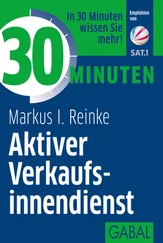Markus W. Behne - HighSpeed.eu
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus W. Behne - HighSpeed.eu» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:HighSpeed.eu
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
HighSpeed.eu: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «HighSpeed.eu»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
HighSpeed.eu — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «HighSpeed.eu», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Abschnitt 10 — Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen
Artikel 52 Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen
1. Investitionsbeihilfen für den Ausbau der Breitbandversorgung sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.
2. Die beihilfefähigen Kosten sind
a) die Investitionskosten für den Ausbau passiver Breitbandinfrastruktur,
b) die Investitionskosten für Baumaßnahmen im Breitbandbereich,
c) die Investitionskosten für den Ausbau der Netze für die Breitbandgrundversorgung und
d) die Investitionskosten für den Ausbau von Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation Access — NGA).
3. Die Investition muss in einem Gebiet getätigt werden, in dem keine Infrastruktur derselben Kategorie (Breitbandgrundversorgung oder NGA) vorhanden ist und in den drei Jahren nach der Veröffentlichung der geplanten Beihilfemaßnahme unter Marktbedingungen voraussichtlich auch nicht aufgebaut wird; dies muss im Rahmen einer öffentlichen Konsultation überprüft werden.
4. Die Beihilfen müssen auf der Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien wettbewerblichen Auswahlverfahrens unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieneutralität gewährt werden.
5. Der Netzbetreiber muss zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen einen möglichst umfassenden Zugang zu den aktiven und passiven Infrastrukturen auf Vorleistungsebene im Sinne des Artikels 2 Nummer 139 einschließlich einer physischen Entbündelung im Falle von NGA-Netzen gewähren. Dieser Zugang auf Vorleistungsebene ist für mindestens sieben Jahre zu gewähren, während das Recht auf Zugang zu Leerrohren und Masten unbefristet bestehen muss.
Im Falle staatlicher Beihilfen für die Finanzierung der Verlegung von Leerrohren müssen diese groß genug für mehrere Kabelnetze sein und auf verschiedene Netztopologien ausgelegt sein.
6. Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene müssen sich auf die Preisfestsetzungsgrundsätze der nationalen Regulierungsbehörde und auf Benchmarks stützen, die in vergleichbaren, wettbewerbsintensiveren Gebieten des Mitgliedstaats beziehungsweise der Union gelten, wobei die dem Netzbetreiber gewährten Beihilfen zu berücksichtigen sind. Die nationale Regulierungsbehörde wird zu den Zugangsbedingungen (einschließlich Preisen) sowie bei Streitigkeiten zwischen den Zugangsinteressenten und dem Betreiber der geförderten Infrastruktur konsultiert.
7. Für Beihilfen über 10 Mio. EUR richten die Mitgliedstaaten einen Überwachungs- und Rückforderungsmechanismus ein.
Die Methode „Verordnung“ verzichtet auf die in „Richtlinien“ notwenige Umsetzung durch die nationalen Gesetzgeber. Dies ist eine klare Vereinfachung in einer stetig gewachsenen Gemeinschaft. Eine Verordnung gilt selbstverständlich nicht nur für Mitgliedstaaten, sondern wie jedes andere Gesetz auch ganz normal für alle Bürgerinnen und Bürger und damit auch für die Unternehmen im Bereich schnelles Internet. Die Regeln einer Verordnung sind nicht nur inhaltlich, sondern auch im Wortlaut überall in der EU gleich.
Die in diesem Planspiel vorzuschlagende Verordnung nimmt die EU-Methode auf, mit neuen Verordnungen bestehende Regelungen zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Ältere Bezeichnungen wie EG und EWG werden dann jeweils neu unter der EU-Bezeichnung geführt. Bleiben ältere Bestimmungen bestehen, bleibt auch deren Bezeichnung bei den Namen der EU-Vorgängerorganisationen. Tatsächlich gelten einige der Verordnungen, die hier behandelt werden, länger als im Planspiel fiktiv dargestellt. Dies ist aus didaktischen Gründen notwendig und eröffnet den Spielerinnen und Spielern Handlungsoptionen, die es in der Realität bis Ende dieses Jahrzehnts so eigentlich nicht mehr gibt. Dieses Planspiel vermischt auch grundsätzlich durch verschiedene Instrumente der EU geregelte Bereiche, damit die Jugendlichen in einem einheitlichen Rahmen beraten und entscheiden können.
2.1 Szenario
Die Europäische Union setzt ihre Politik mit unterschiedlichen Instrumenten um. Oft, wie auch in diesem Fall, definiert die EU zusammen mit den Mitgliedstaaten ihre gemeinsamen Ziele in mittelfristigen Strategien. Aktuell soll mit der „Strategie Europe 2020“ „intelligentes, integratives und nachhaltiges Wachstum“ gefördert werden. Mit dem Kapitel „ Digitale Agenda“ in der Strategie „Europa 2020“ will die Europäische Union den Ausbau des Breitband-Internetsfördern und einen gemeinsamen Markt für internetbezogene Dienstleistungen etablieren sowie allgemein schnellere Netzzugänge ermöglichen. Mit schnellem Internet, Breitbandinfrastruktur oder einfach Breitband wird im Gegensatz zum „Schmalband“ eine größere Datenübertragungsrate pro Sekunde verstanden. Wie groß diese Rate sein muss, um als Breitband akzeptiert zu werden, wird weltweit überall ein wenig unterschiedlich definiert. Die Internationale Fernmeldeunion als UN-Organisation und die Weltbank sehen eine Übertragungsrate von mehr als 2000 kBit/s (Kilobit pro Sekunde) als Breitband. Diese Definition nimmt die Kommission für Ihren Gesetzgebungsvorschlag als Standard für die EU auf.
Grundsätzlich hat die EU durch die Mitgliedstaaten Entscheidungskompetenzen übertragen bekommen, so dass sie in der Gesetzgebung oder durch Entscheidungen für bestimmte Politikfelder gemeinsam für alle Mitgliedstaaten und Völker der EU Regelungen demokratisch und parlamentarisch beschließen kann. Die Artikel 2 bis 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV – ein Teil des Lissabonner Vertrags) regeln die Bereiche und inwiefern die EU zuständig ist, die EU und die Mitgliedstaaten gemeinsam Verantwortung tragen oder nur eine Koordinierung und Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die EU zulässig ist. Zum Teil sind bestimmte Entscheidungskompetenzen auch direkt an einzelne Organe der EU gebunden: Zum Beispiel Wettbewerbs- und Beihilfenkontrolle durch die EU-Kommission oder Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (vgl. Artikel 3 AEUV). Hier im Bereich Beihilfen durch Staaten, also Subventionen, laufen einige der wichtigsten Fragen des Ausbaus des schnellen Internets zusammen. Darf der Staat privaten Unternehmen Geld dafür geben, die Infrastruktur für das schnelle Internet zu errichten? Oder muss er es sogar, damit es überhaupt dazu kommt? Ist das Breitband-Internet eine sogenannte Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse oder ist es nicht nur ein Geschäftsmodell, mit dem einige, wenige Unternehmen richtig viel Geld verdienen wollen? Einige Regeln der neuen Verordnung sind sicher unumstritten, andere aber werden durch die verschiedenen Interessengruppen sehr unterschiedlich beurteilt. Streit ist vorprogrammiert. Streit ist aber auch ein demokratisches Mittel, um eine Regelung zu finden, die möglichst vielen Interessen gerecht wird. Letztlich müssen Mehrheiten organisiert werden.
Die Mehrheiten in den Organen sind von großer Bedeutung für die Entscheidungsfindung. In der Regel kann man sich über Kompromisse von Formulierungen der einzelnen Regeln eine Mehrheit erarbeiten. Manchmal schafft man es besser über Paketlösungen. Auf diesem Weg bekommen möglichst viele Mitstreiter was sie wollen, wenn sie umgekehrt auch für eine Position stimmen, die ihnen eigentlich nicht so wichtig ist oder aus ihrer Sicht eigentlich nicht in das Gesetz gehört. Es ist sinnvoll für die Mitglieder der Kommission, des Rates und des Parlaments auch zu wissen, wie in den jeweils anderen beiden Organen abgestimmt werden wird. Durch ein persönliches Gespräch mit dem einen oder anderen Mitglied der anderen Gruppen kann geschickt Einfluss genommen werden, um das Abstimmungsergebnis zu beeinflussen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «HighSpeed.eu»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «HighSpeed.eu» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «HighSpeed.eu» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.