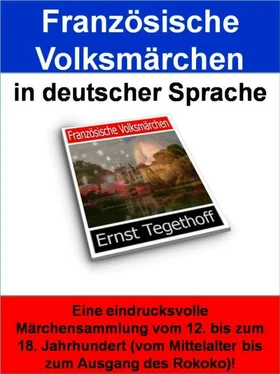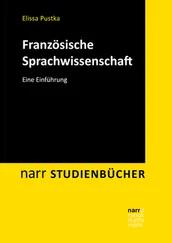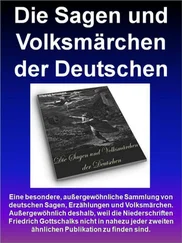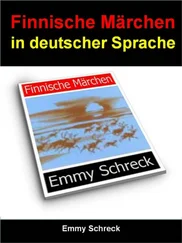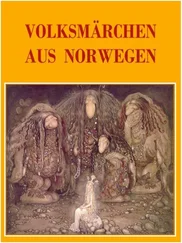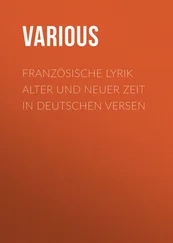Welle der englischen Literaturmode hinweggeflutet,
sie wurden gesammelt, und Sammlungen
beweisen stets, daß das lebendige Interesse an dem
darin gesammelten Objekt im Erlöschen ist.
Die R o m a n t i k bezeichnet den Eintritt der
abendländischen Welt ins Greisenalter; und wie sich
das Alter gern mit einer gewissen sehnsüchtigen Wehmut
vergangener Zeiten erinnert, so lebte jetzt die Anteilnahme
an den Schöpfungen des Volksgeistes neu
auf. Man betrachtete die Märchen mit ehrfürchtiger
Scheu als Produktionen der dichtenden Volksseele
und sah in ihnen einen Abglanz der mythischen Vorstellungen
der germanischen Völker, wodurch das Bemühen
gezeitigt wurde, diese einfältigen Kinder des
Volkes so naturgetreu wie möglich nachzuzeichnen.
Frankreich, das sich von den Anstrengungen der Re-
volution und der napoleonischen Kriege erholen
mußte, erblickte in der Romantik eine willkommene
Reaktion gegen die Überspannung der Jahrhundertwende
und nahm die von Deutschland hereindringende
Strömung willig auf. Während das Drama sich einerseits
bemühte, das historische Kolorit treu zu wahren,
während Victor Hugo im Zeitalter Franz I. den
geeigneten Boden für die Verwirklichung seines
Kunstideals von der Vermischung des Sublimen und
Grotesken erblickte, so fand andererseits der Messias
der Romantik, Shakespeare, in Alfred de Musset seinen
Apostel, der in seinen Märchendramen die Zeitlosigkeit
und sonnenstrahlenhafte Zartheit der Märchengebilde
am besten traf, und der in seiner »Barberine«
nicht ohne Grund dasselbe Zymbelinemärchen verwertete
wie sein großes Vorbild in der Geschichte von
Imogen. Auf dem Gebiete der Novelle wäre vor allem
Nodier zu nennen, der 1842 gemeinsam mit Leroux
de Lincy die »Bibliothèque bleue« wieder aufleben
ließ.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Märchen,
die durch die Brüder Grimm für ganz Europa
angeregt wurde, fand in Frankreich erst spät Nachahmer.
Erst im Jahre 1845 erschien, wenn man von der
kleinen Sammlung Pluquets aus Bayeux von 1832 absehen
will, die Sammlung normannischer Sagen von
Amélie Bosquet, die freilich weniger dem Märchen
dient, und im gleichen Jahre veröffentlichte Souvestre
den ersten Band seiner »Foyers bretons«, ein allzu
individuell gefärbtes Werk, das für die Forschung nahezu
wertlos ist. Von den sechziger Jahren an bemühte
sich eine ganze Anzahl von Sammlern, die Schätze,
die Frankreich noch birgt, unter Dach zu bringen. Vor
allem ist Paul Sébillot, der Schöpfer und das Haupt
der französischen Volkskunde, zu nennen, der nicht
nur weit über seine hochbretonische Heimat hinaus
als zuverlässiger und unermüdlicher Sammler tätig
war, sondern auch in seinem Lebenswerk, dem
»Folklore de France« (1904–07), das gesammelte
Material zu einem Kompendium der französischen
Volkskunde verarbeitete. Paul Sébillot ist der Herausgeber
der wichtigsten volkskundlichen Zeitschrift
Frankreichs, der »Revue des traditions populaires«
(seit 1886). Die meiste Ausbeute bot die Bretagne,
der die Werke von Luzel, Orain, Mme. de Cerny u.a.
angehören. Weiter wären zu nennen die Sammlertätigkeit
Bladés für die Gascogne, Pineaus für Poitou,
Lamberts für Languedoc, Carnoys für die Sommegegend
und nicht den geringsten zuletzt: Cosquins, dessen
treffliche Anmerkungen zu seinen lothringischen
Märchen eine der elementarsten Grundlagen für die
gesamte Märchenforschung darstellen und die hauptsächlich
eine Brücke vom Orient zum modernen Okzident
zu schlagen sich bemühen.
Es war hohe Zeit, die Schätze zu bergen, denn auf
die Romantik folgte das Maschinenzeitalter, jene
Epoche, in welcher die Menschheit in wahnsinniger
Überhebung die Natur zu beherrschen glaubte, bis die
Technik ihren Händen entglitt, eigenes Leben gewann
und in wilder Raserei den Bau der Jahrhunderte zertrümmerte.
Aus älteren Quellen
(Vom Mittelalter bis zum Ausgang des Rokoko)
Zwölftes und dreizehntes Jahrhundert
1. Wie Galopin für Elias von St. Gilles das
Wunderpferd Primsaus von Aragon stahl
Elias von St. Gilles ritt, vom Fluche seines Vaters getroffen,
in die Welt. Nach mannigfachen Abenteuern
überraschte er einst in Spanien vier Räuber beim
Mahl; drei davon erschlug er, den vierten, Namens
Galopin, einen schlauen und behenden Burschen,
nahm er als Diener an. Und bald bedurfte er seiner,
denn bei einem Überfall der Sarazenen wurde Elias
verwundet. Galopin schleppte seinen Herrn in einen
Weingarten und hier erblickte ihn Rosamunde, die
Tochter des Heidenkönigs Macabre. Sie pflegte den
Wunden und heilte ihn mit kräftigen Tränken.
Ein sarazenischer König, Lubien von Baudas, warb
um die Jungfrau und drohte, falls sie ihm verweigert
würde, ihren Vater mit Krieg zu überziehen. Schon
hatte sein Heer Macabres Burg im Halbkreise umschlossen,
doch niemand wagte es, den gewaltigen
Heiden zu bekämpfen. Da erbot sich Rosamunde
selbst, einen Kämpfer gegen den ungeliebten Werber
zu stellen, und sie bat Elias um den Ritterdienst. »O,
Herrin,« sagte Elias, »wie sollte ich einer Frau dienen,
die nicht an meinen Gott glaubt! Aber um des-
sentwillen, was Ihr an mir getan habt, als ich krank
und verwundet dalag, will ich Eurer Bitte willfahren.
Gebt mir Roß und Waffen, so will ich hinausgehen
und meinen Leib gegen Euren Freier zum Pfande setzen.
Bei Gott, ich weiß meine Lanze zu führen, und
kein Heide in Spanien, der Euch beleidigt hat, soll
sich des Sieges rühmen, wenn wir auseinandergehen.«
»Herr,« sagte die Jungfrau, »Ihr macht mich froh. Um
Euretwillen werde ich Mohammed verlassen und mit
Euch nach Frankreich gehen. Aber vor einem hütet
Euch, wenn Ihr mit dem Emir kämpfen wollt. Der
Schurke besitzt ein Streitroß, wie es in Frankreich
keines gibt: es heißt Primsaus von Aragon, Oriande
war seine Mutter. Wenn in der Schlacht das Gedränge
groß ist, dann springt es mit allen vier Beinen auf und
schreit und schlägt mit den Füßen um sich und tötet
jeden, den es trifft. Jeden, der es beim Zügel nimmt,
wirft es zu Boden, er müßte denn trefflich zu turnieren
verstehen.«
Als Galopin dieses Lob hörte, sprang er auf und
trat zu seinem Herrn: »Edler Graf,« sagte er, »was
zaudert Ihr noch? Bittet die Jungfrau, daß sie Euch
Waffen gibt. Ehe nach Mitternacht der erste Hahn
kräht, werde ich Euch das Streitroß verschaffen, allen
Heiden zum Trotz!« Galopin bekleidete sich mit seinem
Mantel – er maß nur drei Fuß – und band sich
hundert Denare um.
Er war ein Spitzbube und kannte sein Handwerk.
Er schlich sich durch die Hintertür und durchwatete
den Bach, der am Schlosse vorbeiströmte; dann eilte
er durch den Weingarten und durchmaß das feindliche
Lager, bis er zum Zelte des Emirs gelangte. »Der
große Mohammed, der die Welt regiert,« rief er Lubien
zu, der vor seinem Zelte saß, »erhalte den Kaiser
und alle, die ihm dienen.« »Freund,« antwortete der
Emir argwöhnisch, »er segne auch dich. Doch sage
mir, wer bist du und aus welchem Lande stammst
du?« Galopin, der Schlaue, entgegnete ihm: »Herr,
von jenseits des Meeres komme ich. Noch gestern
abend bei der Vesper war ich ein reicher Kaufmann,
ich führte ein Schiff, wie noch kein Mensch eines sah,
Читать дальше