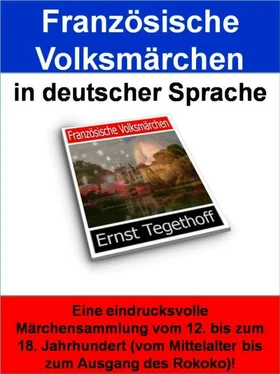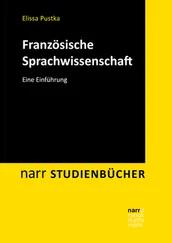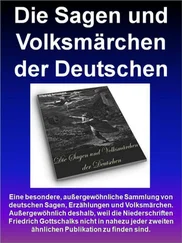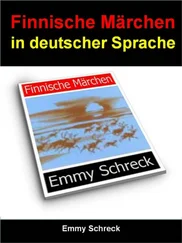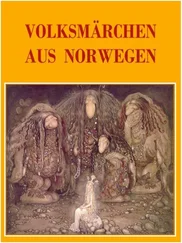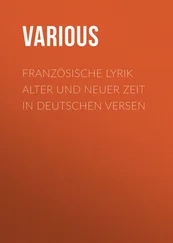Vergröberung und Verspottung des altgermanischen
Riesentypus.
Neben Rabelais verschwinden die Autoren von
S c h w a n k s a m m l u n g e n , die dem von den Fabliaux
und der italienischen Novelle gewiesenen
Wege folgten. 1521 wurden die Gesta Romanorum
unter dem Titel »Violier des histoires romaines«
durch Jehan de la Garde in Paris gedruckt. 1535 eröffnete
Philipp von Vigneuilles mit seinem noch ungedruckten
»Recueil« den Reigen der Nachahmer
Boccaccios, Poggios, Sacchettis und Masuccios, kurz
darauf folgt Nicolaus v. Troyes »Parangon« (1535)
und Bonaventura Desperiers mit seinen »Joyeus
devis«. Der große Nachahmer Lucians, der seinen
Kampf gegen das Christentum 1544 freiwillig beendete,
um den Verfolgungen der Inquisition zu entgehen,
schenkte der Mitwelt hier das Kind seiner heitereren
Muse. Freilich sind drei Viertel der Sammlung
eigene Erfindung. Henri Estienne, der Hugenott und
Hellenist, mischte in seine gegen den Katholizismus
gerichtete »Apologie pour Hérodote« (1566) viele
Schwankstoffe, Noel du Fail erwähnt in seinen
»Contes d'Eutrapel« (1565) und in seinen »Propos
rustiques« eine große Anzahl von Märchen, während
Margarethe von Navarra in ihrer Boccaccionachahmung
(Heptameron 1559) die ernsten Stoffe bevorzugte.
Sie brachte den Ernst, die Tragik und das Mitleid
in die Novelle. Verville mit seinem »Moyen de
parvenir« und die »Élite des contes« des Seigneur
d'Ouville – um nur die bekanntesten Namen zu nennen
– gehören schon dem folgenden Jahrhundert an.
Mit Riesenschritten eilte die französische Kultur
ihrem Kulminationspunkte zu. Der Hof Ludwigs
XIV. wurde der Sammelplatz der Künste und Wissenschaften
der Welt. In goldbestuckten Spiegelsälen
beugten sich betreßte Höflinge, geistreiche Frauen
plauderten in ihren Salons über Descartes, die Sprache,
bald geheimnisvoll flüsternd, bald pathetisch rollend,
verschmähte die Ausdrücke des Pöbels und floh
das Alltägliche, während von den Gobelins die gestickten
Helden der Antike auf die im Winde flatternden
Allongeperücken herabschauten: die Welt Molières,
Corneilles und Racines taucht auf. Die Komödie
suchte ihre Stoffe in Spanien und Italien, die Tragödie
folgte den Spuren des Euripides, alle Länder und Zeiten
trugen zur Verherrlichung des größten Repräsentanten
des Absolutismus bei. Da mußte auch das Märchen
seinen Tribut zahlen: der große Molière hielt das
apulejische Rokokogeschichtchen von Amor und Psy-
che für gut genug zu einem Hofspektakel (1672) und
L a f o n t a i n e , der ihm den Stoff dazu geliefert
hatte, ließ sein zynisch-epikuräisches Weltbild in den
Stoffen der Fabliaux und der Tiermärchen widerstrahlen.
Lafontaine schöpfte seine »Nouvelles en vers«
zumeist aus Boccaccio und Ariost, manche decken
sich mit den Fabliaux, andere gehen bis auf die Antike
zurück. Sein berühmtestes Werk, die »Fables«
(1668–78), gehen den Weg Äsops. Viele davon
haben Parallelen in noch heute erzählten Tiermärchen.
Lafontaine hatte eine fast romantische Vorliebe für
die Märchen, man kennt seine berühmte Stelle: »Si,
Peau d'âne' m'étoit conté, j'y prendrois un plaisir
extrème« (Fables VIII 4), dennoch schöpfte er kaum
je aus dem Volksmund unmittelbar.
Je höher die Zivilisation der Menschheit steigt,
desto weniger naiv steht sie dem Märchen gegenüber,
es wird vom Selbstzweck zum Mittel zum Zweck, es
steigt aus der abendlichen Spinnstube in das Kinderzimmer.
In diesem Jahrhundert, das eine gleichmäßige
Ausbildung aller menschlichen Fähigkeiten erstrebte
– wobei es freilich die wichtigsten, die des Herzens
und der Phantasie, vergaß –, erfüllte das Märchen
eine ähnliche Funktion wie in den Exempeln der Dominikaner:
es sollte moralische Lehren illustrieren,
oder eher umgekehrt: es bekam ein moralisches
Schwänzchen angehängt. 1697 erschienen die
»Contes de ma mère l'oye« von Charles P e r -
r a u l t . Aber Perrault war kein Romantiker. Noch
fünf Jahre zuvor hatte er gesagt: »Les fables milésiennes
sont si puériles, que c'est leur faire assez d'honneur
que de leur opposer nos contes de Peau d'âne
et de la mère l'oye.« Perrault lebt in der Literaturgeschichte
als der geist- und wortreiche Vorkämpfer des
Fortschritts im Kampfe gegen Boileaus antikisierende
Irrgänge, und die Märchen, die sein Sohn auf seine
Veranlassung niederschrieb, erschienen im gleichen
Jahre, in welchem sein Lebenswerk, die »Parallèles
des anciens et modernes« abgeschlossen wurde. Das
Märchen war nur eine Erholung für seine Mußestunden
und er blickte, wie seine ganze Zeit, mit einer gewissen
Verachtung auf diese Jugendverirrungen der
Menschheit herab, die erst durch den Anhang einer
Nutzanwendung Existenzberechtigung erhalten konnten.
Nicht anders wie Perrault stellte sich die Gräfin
A u l n o y zu den Märchen, die sie bearbeitete. Keine
ihrer Erzählungen ist eine getreue Wiedergabe aus
dem Volksmunde, sondern sie nahm die Motive, wo
sie sie gerade fand, und setzte sie mit dem ihrer Zeit
eigenen Geschmack zu jenen gefälligen, drolligen und
etwas moraltriefenden Geschichtchen zusammen, die
einen so ungeheuren Einfluß ausübten und zum Gesamtbild
des Rokoko gehören wie die Bilder Wat-
teaus und die Dramen Marivaux'. Den Ausschlag gab
die Übersetzung aus Tausendundeinenacht, die Galland
im Jahre 1709 brachte. Die Nachahmungen
schossen derart aus dem Boden, daß die Sammlung
all dieser Erzählungen im »Cabinet des fées«, die zu
Ende des 18. Jahrhunderts veranstaltet wurde, nicht
weniger als 41 stattliche Bände füllen konnte. Diese
Feengeschichten, die zumeist von Frauen geschrieben
sind (Gräfin Murat, Gräfin d'Auneuil, Gräfin Hamilton,
Mlle. de la Force u.a.), und die so zierlich und
zerbrechlich sind wie ein Rokokofigürchen, übten
nicht nur auf die schreibende Mitwelt – man denke an
die orientalischen Erzählungen Voltaires – einen tiefgehenden
Einfluß aus, sondern sie zogen auch das lebende
Märchen in ihren Bann, das sich im Volksmund
nach seinem literarischen Vorbild umgestaltete.
So erscheint das Märchen vom dankbaren Toten, das
im Jahre 1725 von Mme. de Gomez unter dem Titel
»Jean de Calais« bearbeitet wurde, in den meisten
französischen Fassungen der Gegenwart abhängig
von diesem literarischen Vorbild. Das germanische
Märchen von Rumpelstilzchen wurde von Mme. l'Héritier
1705 als »Ricdin-Ricdon« modernisiert, und
diese Umformung verdrängte im Volksmund in starkem
Maße die alte Form. Das Märchen von »La belle
et la bête« wurde 1740 von Mme. de Villeneuve erzählt
und erlangte eine solche Verbreitung, daß die
Wissenschaft die außerordentlich verbreiteten volksmäßigen
Varianten dieser Kunstnovelle auf diese letztere
als auf ihre Quelle zurückführen zu sollen glaubte.
Die meisten Kunstmärchen dieser Zeit freilich sind
leere Phantasien: »Gemische aus sogenannten orientalischen
Zauberwesen und modern schäferischen Liebesgeschichten
«, so charakterisieren sie die Brüder
Grimm. Die »Féeries nouvelles« des Grafen Caylus
und die anonymen »Nouveaux contes de fées« aus
dem Jahre 1718 verdienen noch hervorgehoben zu
werden. Die »Contes bleues« wurden durch die eindringende
Читать дальше