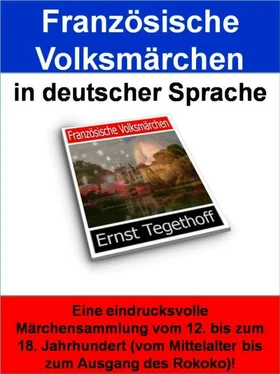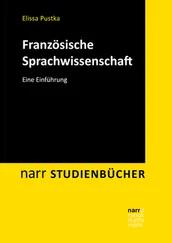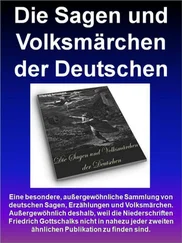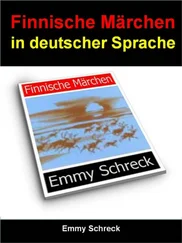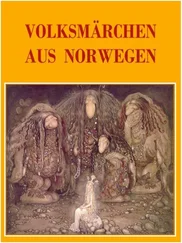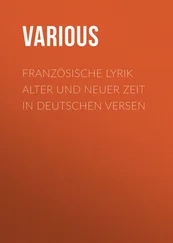Mittelalter bekannt waren – der disciplina clericalis,
dem Dolopathos, dem directorium humanae vitae
und dem Barlaam und Josaphat – nachweisen; viele
dieser Kleinigkeiten sind gewiß auch in Europa und
speziell in Frankreich selbst entstanden. Diese Reimschwänke,
deren Verfasser, die übrigens nur in den
seltensten Fällen mit ihren Namen hervortreten, aus
dem Stand der fahrenden Kleriker und der Berufsspielleute
stammen, sind nicht nur wegen der Verbreitung
ihrer Stoffe wichtig, sondern sie sind auch eine
Fundgrube für den Kulturhistoriker. Sie lehren uns,
worüber das Frankreich des 13. Jahrhunderts gelacht
hat. »Bald leichtsinnig und derb, bald feinsinnig und
bald zynisch, über allzu unbedeutenden Anlaß lachend,
immer spöttisch, selten satirisch, so ist das Fablel
ein wichtiger Zeuge für die niederen Triebe der
galloromanischen Rasse.« So definiert Bédier, der bedeutendste
Erforscher dieser Gattung, die Fabliaux.
Die Schwänke des Mittelalters lebten nicht nur in
Prosa aufgelöst in den unzähligen Schwanksammlungen
der späteren Jahrhunderte fort, sondern sie werden
auch noch in der Gegenwart mit Behagen erzählt.
Nicht nur in Versform, auch in Prosa fanden diese
leichten Stoffe Eingang in die Literatur des Mittelalters,
hier besonders in Form der P r e d i g t m ä r -
l e i n . Die Illustration moralischer Lehren durch Geschichten
novellenhafter Art geht in ihrem Gebrauch
schon auf den Stifter des Christentums zurück. Die
Homilien Gregors des Großen machen zuerst ausgie-
bigen Gebrauch von diesen Erzählungen, die auf
einen populären Hörerkreis zugeschnitten sind. Ein
wichtiges Erziehungsmittel werden sie in den Händen
der Franziskaner und Dominikaner, der eigentlichen
ordines praedicatorum. Diesem Orden gehörte der
große französische Prediger Etienne von Bourbon an,
der in seinem »liber de septum donis spiritus sancti«
ein Kompendium dieser Exempla für den Gebrauch
der Prediger gab, in den meisten Fällen abhängig von
seinem großen Vorgänger Jakob von Vitry, welcher
über 200 Fabeln, Schwänke und Anekdoten in seine
»Sermones vulgares« einschob. Eine weitere Sammlung
von Exemplis mit Nutzanwendungen in anglonormannischer
Sprache gab im 14. Jahrhundert der
englische Franziskaner Nikolaus Bozon. Weiterhin
wäre die »Summa virtutum ac vitium« des Wilhelm
Peraldus und die »Fleurs des commandemens de
Dieu« zu erwähnen. Das »Speculum exemplorum«,
das wahrscheinlich in Belgien entstand, wurde noch
im 17. Jahrhundert von einem Jesuiten aus Douai, Johannes
Major, bearbeitet. Zu diesen Sammlungen gehört
auch das berühmteste Märchenbuch des Mittelalters,
die Gesta Romanorum, dessen Ursprungsland
nach den neuesten Forschungen das von französischem
Einflusse abhängige England ist. Aus dem 14.
Jahrhundert ragt die Sammlung »Scala caeli« hervor,
die den Dominikanermönch Johann Junior Gobii aus
Alais in Südfrankreich zum Verfasser hat. Die »Scala
caeli« wird besonders dadurch wichtig, daß sie zum
ersten Male auch eigentliche Zaubermärchen für Predigtzwecke
verwertet. Das Märchen vom dankbaren
Toten, das wir aus diesem Werk bringen, begegnet
übrigens auch in einer Reihe von epischen Werken
des französischen Mittelalters: dem Hervis de Metz,
dem Richars li biaus und dem Lion de Bourges.
Wir dürfen den Boden des Mittelalters nicht verlassen,
ohne auch des Tiermärchens zu gedenken, das im
französischen »Roman de Renart« seine klassische
Verwertung fand. Die Quellen des mittelalterlichen
T i e r e p o s sind mannigfacher Art, nicht nur die antike
Fabel und das indische Pantschatandra, sondern
auch die nordgermanischen und finnischen Völker,
die den Bären in den Mittelpunkt einer Tierfabelkette
stellten, tragen das ihrige zur Ausbildung dieser
Dichtgattung bei.
Der Hochblüte mittelalterlicher Dichtkunst, die in
Frankreich in die letzten Jahrzehnte des 12. und den
Beginn des 13. Jahrhunderts fällt, folgte eine Erschlaffung,
die auf unserem Gebiet durch das Zurücktreten
der Zaubermärchen und das Überhandnehmen
der Schwankstoffe charakterisiert wird: im 14. und
15. Jahrhundert wurde in Italien die N o v e l l e geboren,
und sie drang alsbald nach Frankreich: noch dem
15. Jahrhundert gehört die Sammlung der »cent nou-
velles nouvelles« an. Das 15. Jahrhundert ist bemerkenswert
durch die P r o s a a u f l ö s u n g der alten
Versepen, die nunmehr durch Aufnahme märchenhafter
Wanderstoffe im prosaischen Gewande anschwellen.
Der »Perceforest«, dem im übrigen kein Versroman
zugrunde liegt, bietet uns die älteste Version des
Dornröschenmärchens, der »Zauberer Virgilius«
nahm das orientalische Märchen vom Geist in der
Flasche auf, und der »Ogier« bereicherte sich um ein
Mahrtenehemärchen.
Gleichzeitig mit dem Prosaroman blühte das
D r a m a , das neben der heiligen Geschichte (in den
Mystères) auch Stoffe schwank- und märchenhafter
Art in den Farcen und Moralitäten pflegte. So begegnet
in einer Farce des Eustache Deschamps († 1415)
jener schlaue Betrüger Trubert wieder, der uns oben
in Zusammenhang mit dem Meisterdiebmärchen beschäftigte.
Das 16. Jahrhundert zeigt die Völker des Abendlandes
in der Blüte ihrer ersten Mannesjahre: es war
eine Zeit, die sich stürmisch von liebgewordenen Jugendträumen
losriß, die wild von Tat zu Tat eilte, in
der jeder Tag einen Markstein in der Geschichte bedeutet.
Das christliche Jenseitsideal konnte dem
immer reicher werdenden Erdenleben nicht mehr Genüge
tun, das Jahrhundert wandte seinen Sinn auf das
Irdische, ein Bestreben, das es der Antike näher führ-
te, die nun ihre glänzende Auferstehung feierte. Aber
neben antiker Formenpracht, neben religiöser Erneuerung
lebte die gotische Barbarei fort. Es war ein Jahrhundert
der Gegensätze. Während de Baïf die »Elektra
« übersetzte, während Calvin seine »Institutiones«
schrieb, versammelte sich der französische Hof in
Lyon und betrachtete mit Stielgläsern, wie Montecucculi,
der des Giftmordes am Dauphin bezichtigt war,
von vier Pferden auseinandergerissen wurde, und die
Höflinge schlossen Wetten ab, welches Glied der Gewalt
der aufgepeitschten Rosse am längsten Widerstand
leisten würde. Nur Margaretha von Angoulême,
die feinfühlige Dichterin, verbarg ihr Haupt an der
Schulter ihres königlichen Bruders. Die Hinwendung
zum Realen und die Ausbildung des Individuellen
konnte dem Märchen keinen Vorschub leisten: das
16. Jahrhundert setzte die Entwicklung vom Zaubermärchen
zum Schwank in verschärftem Tempo fort:
die ungestüme Lebenskraft der Zeit äußert sich im
Schwank und in der derben Faschingsposse, man
nimmt das Menschliche menschlich. Es ist das Jahrhundert
des F r a n ç o i s R a b e l a i s . Sein
»Gargantua« (1532) ist nichts anderes als eine gigantische
Verzerrung des Märchens vom starken
Hans, ein Märchentypus, der auf die Jugendgeschichte
des germanischen Siegfried sowohl wie des finnischen
Kullervo eingewirkt hatte, der aber in Frankreich
durch die Tätigkeit der Spielleute, die im Rainouart
des Karlszyklus ein Vorbild des Rabelaisschen Helden
schufen, und nicht ohne Einwirkung des keltischen
Hanges zur Groteske jene Form erreichte, die
das Märchen noch heute im Volksmund festhält: eine
Читать дальше