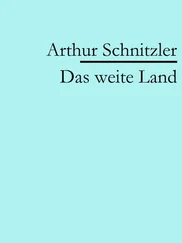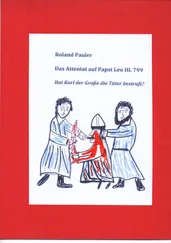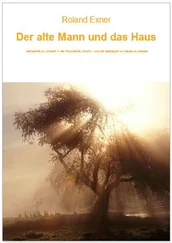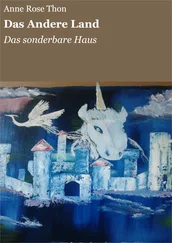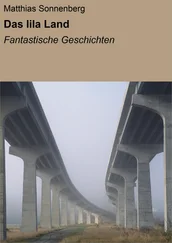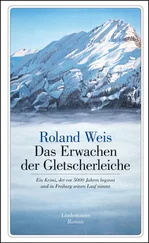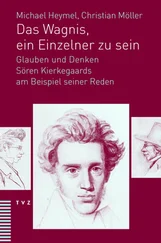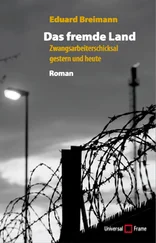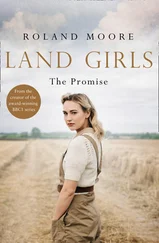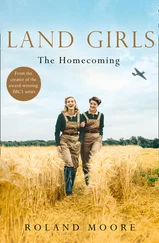Im Übrigen fand man genügend Obst. Jeden Sommer Melonen und Süßkirschen, Pfirsiche und Ananas in der Dose (ich glaub für 6 Mark aus dem „Wucherladen“), und natürlich Äpfel, Birnen, Pflaumen usw. Ja, es gab sogar Butter in der DDR! Einmal fragte mich eine Freundin aus Reinbek bei Hamburg, studiert und als „SPIEGEL“-Mitarbeiterin alles nur nicht weltfremd, ob es denn in der DDR richtige Butter gab. Glücklicherweise muss man sich heute 25 Jahre nach der staatlichen Einheit nur noch selten so einen Unsinn anhören. Zu einem Zeitpunkt war Gemüse in Leipzig im Überfluss vorhanden, aber niemand aß es. Berge von Blattsalat in der Mensa der Universität Leipzig zum Beispiel, die im Müll landeten. Es waren die Wochen nach Tschernobyl 1986…
Es gab auch genügend Süßes, „Bambini“, „Nudossi“ (das „Nutella“ der DDR) oder „Moskauer Eis“. Es ist spannend, wenn man ein Produkt von früher wieder probiert. „Bambini“ zum Beispiel, eine Schokolade, die mir heute zu süß ist. Genau wie die „Vita-Cola“. Oder man erinnert sich wieder an spezifische Dinge; so trank ich als Kind fast täglich grünen Waldmeistersirup mit Wasser gemischt. Und natürlich denkt man nicht ohne Wehmut an die Preise von damals: Brötchen 5 Pfennig (Fettbrötchen 7), Pfannkuchen 20 Pf, Bratwürste 1 Mark. Ein ganzer Broiler (Brathähnchen) kostete 6 M, ein Marzipanbrot 3 oder 6 M, Butter 2,50 M. Brot war so billig, dass es in der Landwirtschaft an die Schweine verfüttert wurde. Die Preise waren in den großen Geschäften überall gleich, nicht unbedingt ein Nachteil. Zum „Ärgern“ hier noch ein paar Preise für Dienstleistungen in der DDR: Männer-Friseur 1 Mark (!), nach 89 7,50 DM, heute ca. 15-20 Euro; Kino 0,50 – 2 M. Meine Eltern gaben einmal im Monat einen großen Sack in die Wäscherei: 40 M, also (doppelt) umgerechnet 10 Euro. Dafür gibt’s heute eventuell zwei gebügelte Hemden – ohne Abhol-Service.
Oder die Preise in Gaststätten. Zum Beispiel im berühmten „Kaffeebaum Leipzig“, laut Speisekarte von 1972: die allbekannte Ukrainische Soljanka mit Brötchen 1,40 DDR-Mark, Entenbraten mit Rotkohl und Klößen 4,40 (= 2,20 DM = 1,20 Euro!), Sauerbraten 3,35 Mark, heute ca. 12-15 Euro, Bananenkompott 1 Mark, 1 Urkostritzer Bier 0,25 l für 0,63 M, aber dafür teurer sowjetischer Sekt à 21,50 M, Rotkäppchen Sekt 18,50 M, ein Glas Apfelsaft nur 0,70 M und eine Tasse Kaffee 0,94 M.
Bestimmte Präferenzen beim Geschmack sind bei mir geblieben. So bevorzuge ich weiterhin den „Ost-Senf“ aus Bautzen und Altenburg. In der (natürlich subjektiven) Erinnerung haben auch die Bäckerbrötchen nicht so pappig wie heute geschmeckt. Ein „Radeberger“-Bier ist jetzt überall erhältlich und hat seine ehemalige Exklusivität verloren. Unverändert im Geschmack ist Coca-Cola geblieben (die DDR gehörte ab den 70-er Jahren zur globalen „Pepsi“-Zone). Oder die Fischdose „Scomber-Mix“ und Brathering von der Ostsee.
Die Nachwende-90-er Jahre waren ohne Zweifel Aufbruchjahre für Leipzig, der „Aufbau Ost“ wurde hier sichtbarer als woanders, genauso wie ein „Abbruch Ost“. Das Stadtbild hat sich in vielen Vierteln verwestlicht, dennoch blieb der Grundcharakter der Stadt glücklicherweise erhalten. Einmal gab es eine Diskussion, inwieweit Leipzig mehr klotzen als kleckern müsste, im Sinne einer mehr weltstädtischen Silhouette. 1996/97 wollte der Münchner Milliardär und ehemalige Leipziger Manfred Rübesam ein futuristisches „Klein-Manhattan“ am Karl-Heine-Kanal im Westteil der Stadt aus dem Boden stampfen. „In 20 Jahren ist Leipzig die attraktivste Stadt der Welt… Mit der Schwebebahn zum „Olympia-Gelände“ fahren…“ Das war nun in der Tat nicht gerade ein bescheidenes Unterfangen, aber vielleicht hätte man einiges doch verwirklichen können. Aber nein, der damalige Bürgermeister-Import aus Hannover, Lehmann-Grube, bügelte den Investor ab mit den Worten: „Lassen Sie mich mit Ihren Ideen zufrieden!“ (LVZ/Sachsen-Zeitung, 23.1.97). Der Baudezernent war Rübesams Träumen nicht grundsätzlich abgeneigt, und der Stadt wären keine Kosten entstanden… OBM Tiefensee hätte das vermutlich anders gehandhabt.
Die 90-er Jahre waren in der Stadt auch ein Ringen um die Umbenennung von Straßen. Einige Straßennamen, die nach 1945 geändert wurden, waren im alltäglichen Wortschatz sowieso nicht im Gebrauch, vor allem die Eisenbahnstraße statt „Ernst-Thälmann-Str.“ und die Dresdner Straße statt „Straße der Befreiung 8.Mai 1945“. Insgesamt wurden 38 Straßen nach 1989 umbenannt. Nicht unerwartet traf dies für folgende zu: Leninstraße, Straße des Komsomol, Straße der Aktivisten / Bauarbeiter / Völkerfreundschaft / Waffenbrüderschaft (!) / NVA / DSF / Jungen Pioniere. Ferner verschwanden von den Straßenschildern Ho Chi Minh, Karl Marx, verdiente Kommunisten wie Erich Ferl, aber auch Topspion Richard Sorge und Spartakus. Spartakusstraße, das klingt doch toll, oder? Aus Krakower wurde Krakauer Straße, aus Brnoer Brünner. Dran glauben mussten auch ausländische Kommunisten wie Georgi Dimitroff und Maurice Thorez. Besonders häufig wurde im Laufe der jüngsten Geschichte eine Straße in Leipzig umbenannt, die Magistrale vom Zentrum bis zum „Kreuz“ (Stele aus dem Mittelalter) in Connewitz. Vor 1933 „Südstraße“, dann „Adolf-Hitler-Straße“, nach 1945 „Karl-Liebknecht-Straße“; viele Leipziger nannten die Straße noch in den 50-er und 60-er Jahren „Adolf Südknecht-Straße“. Leider nicht wieder ihren alten Namen erhielt die Straße, in der ich wohne. Ferdinand Lassalle musste bislang seinen Platz nicht wieder an Bismarck abgeben. So wie seit 1990 die SPD den OBM stellt, wurden auch viele Straßennamen (re-)sozialdemokratisiert.
Laufe ich heute durch die Stadt, sind es bestimmte Fixpunkte, die eine Brücke zum Gestern schlagen. Eher nicht das Alte Rathaus aus dem 15. Jh. oder das Völkerschlachtdenkmal von 1913, sondern zum Beispiel der „steile Zahn“, das Uni-Hochhaus der ehemaligen Karl-Marx-Universität, der KMU („Kaffee mit Universität“) oder die „Blechbüchse“, jetzt die „Höfe am Brühl“. Begeistert bin ich vom Neubau des „Paulinums“ am Augustusplatz. Nachdem dort über 30 Jahre ein unansehnliches Plattenbau-Bürogebäude der Uni mit dem nicht besonders ästhetischen Marx-Relief thronte, entsteht auf dem ursprünglichen Gelände wieder die 1968 von Ulbricht gesprengte Pauliner-Kirche, fast wie Phönix aus der Asche. Es ist schade, dass sich kleinkariert seit Jahren über eine Glaswand vor dem Altar gestritten wird. Ich freue mich auf die endgültige Wiederauferstehung dieser Landmarke Leipzigs, mit oder ohne Glaswand. Dann erst ist meiner Meinung die auch architektonische Herrschaft der SED über Leipzig optisch im Stadtzentrum endgültig beendet. Meine Oma hätte Tränen in den Augen, wenn sie das noch erleben könnte.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.