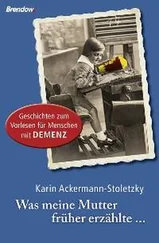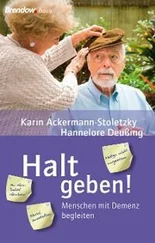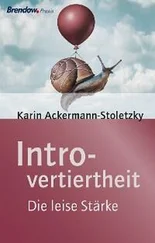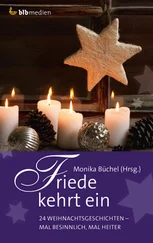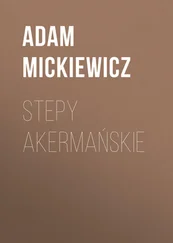„Alle Symptome der unheilbaren Krankheit sind rückfahrbar auf das unbegreifliche Wirken des Todesvirus, mit dem wir in die Welt treten.“ (S. 134) Wiederum bleibt unbedacht, dass wir eben nicht, Elementarteilchen gleich, in die Welt treten, sondern vielmehr passivisch in die Welt „getreten werden“. – Dass es Verursacher jener von Améry aufgezeigten „unheilbaren Krankheit“ gibt, mit denen er sich aus welchen Gründen immer nicht auseinandersetzen mochte: Eltern, die ihn in die Welt treten ließen.
 Blinder Fleck,
Blinder Fleck,  Elternschuld
Elternschuld
Altersheime, Seniorenresidenzen
Euphemismen für  Gerontolager
Gerontolager
Zahlreiche Eltern tendieren dahin, die Zeugung eines Kindes so vorzustellen, als geschehe sie zum Wohle des Kindes. – Als wäre eine Zeugung ein altruistischer Akt. Wenn wir allerdings fragen, wie viele Iche beteiligt sind, so sehen wir, dass ein nutznießendes Kindes-Ich nicht dabei ist. Zeugungen sind und bleiben egoistisch, solange wir nicht sagen, sie geschähen  staatsnatalistisch und massenegoistisch zum Wohle eines größeren Ganzen.
staatsnatalistisch und massenegoistisch zum Wohle eines größeren Ganzen.
Amphibolie des Existenzbegriffs
Bei der Amphibolie des Existenzbegriffs handelt es sich um Trugschlüsse, die durch die Grammatik der Sprache nahegelegt werden. Klassische Beispiele sind Sätze der Art: „Es war gut (schlecht) für mich, dass ich zu existieren begann.“
 Salto esistenziale,
Salto esistenziale,  Salto natale
Salto natale
Anaxagoras’ Anthropodizee
Anaxagoras war ein Zeitgenosse des Sophokles im Athen des 5. vorchristlichen Jahrhunderts. Während Sophokles in seinem Ödipus von Kolonos den Ausruf tätigen ließ, dass Beste sei es, nicht geboren zu sein, warf Anaxagoras (so Aristoteles in seiner Eudemischen Ethik) die Frage auf, aus welchem Grunde wohl ein Mensch sich entscheiden könnte, lieber geboren als nicht geboren zu sein. Anaxagoras’ Antwort lautet: „um das Himmelsgebäude zu betrachten und die Ordnung im Weltall.“ (Zit. nach Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Bd. 1, S. 16f).
In der Darstellung  Blumenbergs sind die Frage und die Antwort Anaxagoras’ überaus bemerkenswert, „weil er die nackte Frage herauspräpariert, was das Faktum des Lebens – als solches einmal hingenommen und ohne die gedankliche Konstruktion einer möglichen Wahl zuvor – rechtfertigen könnte.“ (A.a.O., S. 17) In dem Maße, in dem diese Deutung zutrifft, dürfen wir in Anaxagoras einen vorsokratischen Entdecker und Bearbeiter des Problems der Anthropodizee erblicken, von dem Blumenberg sagt, es gehöre in den „philosophischen Untergrund“: „Wie auch immer es mit der Antwort des Anaxagoras bestellt sein mag, die Frage, der er sich stellt, gehört in den philosophischen Untergrund und tritt spätestens zutage, wenn Kant aus der Unmöglichkeit, die Zustimmung der ins Leben Tretenden zuvor einzuholen, die Folgerung der ihnen rechtlich durch ihre Erzeuger geschuldeten Kompensation zieht, sie nachträglich mit der ungewollten Existenz zu versöhnen und ihnen dadurch die eigene Zustimmung zu diesem Faktum zu ermöglichen.“ (Ebd.)
Blumenbergs sind die Frage und die Antwort Anaxagoras’ überaus bemerkenswert, „weil er die nackte Frage herauspräpariert, was das Faktum des Lebens – als solches einmal hingenommen und ohne die gedankliche Konstruktion einer möglichen Wahl zuvor – rechtfertigen könnte.“ (A.a.O., S. 17) In dem Maße, in dem diese Deutung zutrifft, dürfen wir in Anaxagoras einen vorsokratischen Entdecker und Bearbeiter des Problems der Anthropodizee erblicken, von dem Blumenberg sagt, es gehöre in den „philosophischen Untergrund“: „Wie auch immer es mit der Antwort des Anaxagoras bestellt sein mag, die Frage, der er sich stellt, gehört in den philosophischen Untergrund und tritt spätestens zutage, wenn Kant aus der Unmöglichkeit, die Zustimmung der ins Leben Tretenden zuvor einzuholen, die Folgerung der ihnen rechtlich durch ihre Erzeuger geschuldeten Kompensation zieht, sie nachträglich mit der ungewollten Existenz zu versöhnen und ihnen dadurch die eigene Zustimmung zu diesem Faktum zu ermöglichen.“ (Ebd.)
Während Kants Rechtfertigung der ungefragten Hervorbringung neuer Menschen darin besteht, dass Eltern diesen bis zum Eintritt der Volljährigkeit das Leben pädagogisch und materiell so zu gestalten haben, dass die Kinder das Dasein selbstbestimmt gewählt haben würden – hätten sie denn die Wahl gehabt – ist die Anthropodizee des Anaxagoras auf die theoretisierende Anschauung des Kosmos beschränkt, bei der der Mensch im Grunde jedoch ein distanziert schauender Fremder bleibt, da er weder in einen Schöpfungsplan eingebunden ist, noch sonstwie teleologisch ausgezeichnet oder Endzweck:
„Ganz anders jene Antwort des Anaxagoras auf die Frage, welches Ziel es wohl für den Menschen rechtfertigen könnte, sich dafür zu entscheiden, lieber geboren als nicht geboren zu sein. Sie sieht den Menschen weder im Zusammenhang eines Kosmos, der als solcher gerechtfertigt wäre, noch als den Vollstrecker einer Bestimmung die ihm – von wem auch? – mitgegeben wäre. Sie sieht den Kosmos als ein Angebot, durch die Wahl der theoretischen Handlung das Leben zu rechtfertigen und für sich anzunehmen. Der Kosmos ist der Glücksfall für den Menschen, obwohl er nicht für den Menschen ist.“ (A.a.O. S. 18)
Anders, Günther (1902-1992)
Gegen die antinatalistische Versuchung: Obwohl Günther Anders wie kaum ein zweiter Philosoph alle Menschen im Schatten der Atomwaffen als vernichtbar dachte, scheint ihm der Antinatalismus als Ethik vollkommen fremd geblieben zu sein. Dies erstaunt, da ein allgemeiner freiwilliger Zeugungsverzicht das sicherste Mittel wäre, Menschen vor dem Strahlentod (  Abtreibung
Abtreibung  Vilar). Anders indes scheint dem sich aus der Mutterschaft ergebenden Sinngewinn den ethischen Vorrang vor der Verhinderung zusätzlicher Strahlentoter einzuräumen:
Vilar). Anders indes scheint dem sich aus der Mutterschaft ergebenden Sinngewinn den ethischen Vorrang vor der Verhinderung zusätzlicher Strahlentoter einzuräumen:
„Es ist ganz in der Ordnung, dass sich die Mutter, die ihren Lebenssinn in der Aufzucht ihrer Kinder sieht, keine Zeit nimmt zu fragen, welchen Sinn denn deren Kinder einmal haben werden, und dann deren Kinder usf. Und wahrscheinlich hat sie nicht nur nicht die Pflicht, dieser absurden Gedankenkette nachzugehen, umgekehrt hätte sie, wenn sie (unbegreiflicherweise) durch die Iteration versucht würde, dieser Versuchung zu widerstehen.“ (Antiquiertheit 2, S. 389)
Allen Ernstes scheint Anders hier auszusprechen, dass eine Mutter, der in Ansehung aller aus der dritten industriellen Revolution hervorgegangenen Vernichtungswaffen Zweifel kommen, ob es sinnvoll ist, ein Kind zu zeugen – das seinerseits im Schatten der Bombe lebende Kinder zeugen wird –, die Pflicht hätte, der antinatalistischen Versuchung zu widerstehen. Anders argumentiert als Pronatalist, dem das Kind Sinnlieferant für die erziehende Mutter zu sein hat, ungeachtet der Leiderfahrungen, die das Kind durchmachen wird oder des grauenhaften Todes, den moderne Vernichtungswaffen dem Kind bescheren mögen. Kurz nach obigem Zitat formuliert Anders:
„Erkennen wir als letzten Sinn eines Produktes, an dem wir mitarbeiten, die Vernichtung der Menschheit, dann wissen wir, was wir zu tun, bzw. zu unterlassen haben. Die weitere Frage, etwa die, welchen Sinn es haben solle, dass es eine Menschheit gebe und nicht vielmehr keine, ist höchstens im Bereich der theoretischen Vernunft sinnvoll (wenn auch unbeantwortbar), für die „praktische Vernunft“ dagegen uninteressant. Den Moralisten geht sie nichts an.“ (Ant. 2, S. 390)
Anders verkennt, dass jeder einzelne Mensch auf dem Wege der Fortpflanzung sein Votum darüber abgeben kann, ob es eine Menschheit geben soll oder nicht. Die Frage, ob eine Menschheit sein soll, ist eine Frage alltäglicher Praxis, die gerade auch in Anbetracht der von Anders philosophisch durchdrungenen Massenvernichtungsmittel verneint werden sollte. Er selbst verlangt, Arbeiter, Wissenschaftler und Techniker sollten sich der Frage nach dem letzten Sinn ihres Tuns nicht verschließen, auch wenn sie dies vorerst eine „Zumutung“ nennen würden. „Da es seit 1945 um das „to be or not to be“ der Menschheit geht, ist es wahrhaftig nicht zu teuer bezahlt, wenn man sich durch diese „Zumutung“ der Lächerlichkeit aussetzt.“ (Ant. 2, 390) Der  blinde Fleck des Moralisten Anders besteht darin, dass er die fremdnützig sinnstiftende Zeugung weiterer Menschen auch nach 1945 noch befürwortet und ihnen den jederzeit über sie kommen könnenden Strahlentod zumutet.
blinde Fleck des Moralisten Anders besteht darin, dass er die fremdnützig sinnstiftende Zeugung weiterer Menschen auch nach 1945 noch befürwortet und ihnen den jederzeit über sie kommen könnenden Strahlentod zumutet.
Читать дальше
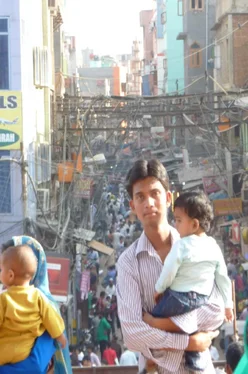
 Blinder Fleck,
Blinder Fleck,