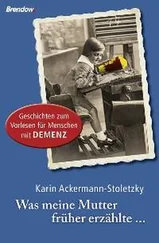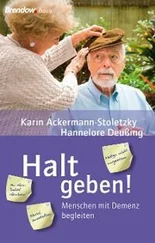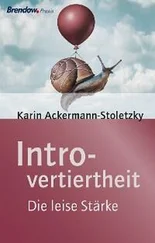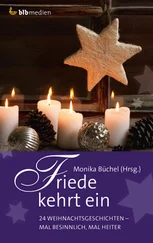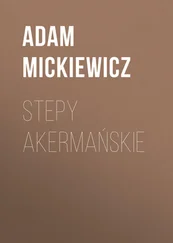Gegen die Ruhigstellung des Sinnverlangens durch Alltägliches, gegen Alltags-Anthropodizeen Marquardscher Machart, haben Dichter und Denker schon immer Einspruch erhoben, Günter Eich mit diesen Worten:
„Ich beneide sie alle, die vergessen können, / die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. / Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit: / erreichtes Urlaubsziel, Nordseebad, Notre Dame, / roter Burgunder im Glas und der Tag des Gehaltsempfangs. / Im Grunde aber meine ich, daß auch das gute Gewissen nicht ausreicht, / und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. / Es gibt kein reines Glück mehr (– gab es das jemals –), / und ich möchte den einen oder andern Schläfer aufwecken können / und ihm sagen, es ist gut so.
Fuhrest auch du einmal aus den Armen der Liebe auf, / weil ein Schrei dein Ohr traf, jener Schrei, / den unaufhörlich die Erde ausschreit und den du sonst / für das Geräusch des Regens halten magst / oder für das Rauschen des Winds. / Sieh, was es gibt: Gefängnis und Folterung, / Blindheit und Lähmung, Tod in vieler Gestalt, / den körperlosen Schmerz und die Angst, die das Leben meint. / Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde, / und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung. / Alles, was geschieht, geht dich an.“ (Günter Eich, Träume. Vier Spiele, S. 141)
Kirsch, Sarah (1935–2013)
Mit ihrem Gedicht ERDRAUCH bezieht auch Sarah Kirsch Stellung gegen den von Marquard empfohlenen Rückzug ins Alltägliche:
Erdrauch
„Und zu verschiedenen Zeiten geschieht es, / Dass wir sehr glücklich über / Irgendein Ding, eine Nachricht. / Den neuen Geliebten, das Kind / Umhergehen können. Da freut uns / Die eintönigste Arbeit. Da kochen wir / Wunderbare Gerichte, putzen die Fenster / Und singen dabei. Küssen / Die eben aufgesprungene Blüte / Am Strauch vor der Tür. Reden / Zu Unbekannten über die Straße / Und beachten die Sonne nicht, / Den leichten, tanzenden Schnee. / Es ist alles bekannt und vertraut. / So wird es immer sein, glauben wir. / Und noch die furchtbaren Bilder / In den Fernsehgeräten bestärken uns / Wenigstens hier wird es so bleiben. Wir stapeln / Die Zeitungen, die uns ruhig schlafen lassen, / Sorgfältig auf, bis sie abgeholt werden. / Wir sind ganz lebendig. Hüpfen und springen / In den möblierten Wohnungen des Todes“ (Zit. in: Beck (Hg.) Jahr- und Tagebuch, S. 34)
Wer neben anderen alltäglichen Verrichtungen das Baby zu füttern hat, kommt laut Marquard ständig zu spät zum Rendez-vous mit dem absoluten Nein. Kirschs Gedicht bietet eine Parallelwelt zu Marquards existentieller Schlaftablette. Auch die von Kirsch evozierte Welt ist mit ablenkender Hausarbeit und einem Kind ausstaffiert. Anders als Marquard, führt sie ihren Lesern vor Augen, dass die Einrichtung unserer Lebenswelt mit Kind und Kegel, die den Anprall der Conditio in/humana abwehren soll, am Ende kollabiert. Wenn „der Lack ab ist“, offenbart sich, dass nicht allein wir selbst in Wohnungen des Todes lebten, sondern in Gestalt von Babys – aus Angst vor dem, was hinter der Tapete lauert – uns Mitbewohner zulegten. Wohlgemerkt keine Mitbewohner, die um Einlass begehrt hätten.
Altenberg, Peter (1859–1919)
Der Wiener Exzentiker wartet mit Texten auf, die ihn weit über das Genre der Kaffehausliteratur hinausheben und den Vorgarten des Antinatalismus betreten lassen:
„Also Ihr, Menschelein, seid zufällig da, hineingeboren in eine der kompliziertesten merkwürdigsten Welten, die es je gegeben hat, und Ihr nützet es nicht einmal richtig aus, vorhanden zu sein,
für hoffentlich nicht viel länger als 80 Jahre,
sondern Ihr begehet ganz unnötige Dummheiten, von Jahr zu Jahr ärgere!?!
Wehe, nein, Gott sei Dank! Sie vernichten vorzeitig rechtzeitig sich selbst!“ (Altenberg, Peter: Mein Lebensabend, S. 134f)
Der sonst kein Blatt vor den Mund nehmende Altenberg übt sich in  Akkusationszurückhaltung. Wir werden dargestellt als zufällig hineingeboren in die Welt, als wären wir Produkte einer chemischen Reaktion. Kein Wort über vorgängige generative Entscheidungen oder die Zeugung, die allem Hineingeborenwerden vorangeht.
Akkusationszurückhaltung. Wir werden dargestellt als zufällig hineingeboren in die Welt, als wären wir Produkte einer chemischen Reaktion. Kein Wort über vorgängige generative Entscheidungen oder die Zeugung, die allem Hineingeborenwerden vorangeht.
In seinen „Märchen des Lebens“ verquickt Peter Altenberg auf unnachahmliche Weise die Verurteilung der Frauen zum  Gattungsdienst und den
Gattungsdienst und den  Gebärterror, mit
Gebärterror, mit  Nächstentoderfahrungen, der Daseinsverurteilung jedes Gebürtigen und der
Nächstentoderfahrungen, der Daseinsverurteilung jedes Gebürtigen und der  Thanatalität:
Thanatalität:
„Meine Mama ist tot. Nichts von ihr ist übrig, sie ist aus der Welt verschwunden. (...) Vor einigen Tagen stand ich nachts 2 Uhr vor dem Hause Franzensbrückenstraße 3. Ich sah zu den dunklen Fenstern hinauf im 2. Stockwerk. Hier also, um diese stille Stunde, war meine schöne Mama in unendlichen Leiden gelegen, hatte mich zur Welt gebracht. Ich hörte gleichsam mein erstes Winseln, sah Mama zu Tode erschöpft von ihrer Lebenspflicht.
Also ich war da; das Verhängnis meines Daseins war nicht mehr rückgängig zu machen, ich war verurteilt für die endlosen Verirrungen; ich schrie [  Schreien], aber die Hebamme sagte wahrscheinlich: »O, eine gesunde Lunge!«
Schreien], aber die Hebamme sagte wahrscheinlich: »O, eine gesunde Lunge!«
Nun stehe ich da, vor diesen Fenstern, in derselben Nachtstunde, höre gleichsam Mamas Seufzer wieder. Ich bin glatzköpfig und ziemlich verkommen und 48 Jahre alt und habe es zu nichts gebracht trotz herrlicher Anlagen.“ (Altenberg, Peter: Was der Tag mir zuträgt, S. 172f)
 Gefangene des Lebens,
Gefangene des Lebens,  Kinderwunsch,
Kinderwunsch,  Kindes-Verfluchung,
Kindes-Verfluchung,  Krankheit,
Krankheit,  Neugeboren,
Neugeboren,  Wozu ist man geboren?
Wozu ist man geboren?
Emotionaler Zustand, in dem ein erheblicher Bevölkerungsanteil (post-)industrialisierter Gesellschaften lebt, der aber auch und gerade traditionellen Gesellschaften nicht fremd ist, wie aus der Hervorbringung zahlreichen Nachwuchses als Maßnahme zur Altersvorsorge erhellt. Eltern muten es ihren Kindern ganz unbedacht zu, ihrerseits in Altersangst{9} zu existieren.
Zur Conditio in/humana gehört, dass fast alle Gesellschaften aller Zeiten – unsere Gegenwart nicht ausgenommen – ihren Alten zu verstehen geben, dass sie überflüssig sind. Anders als die wohl nur von wenigen empfundene „Schuld“, überhaupt geboren worden zu sein (  Entschuldigung, dass ich geboren bin!), dürfte die Scham, alt geworden zu sein, sehr verbreitet sein; unter Frauen eher noch als unter Männern, sodass Hedwig Dohm 1903 notierte:
Entschuldigung, dass ich geboren bin!), dürfte die Scham, alt geworden zu sein, sehr verbreitet sein; unter Frauen eher noch als unter Männern, sodass Hedwig Dohm 1903 notierte:
Читать дальше
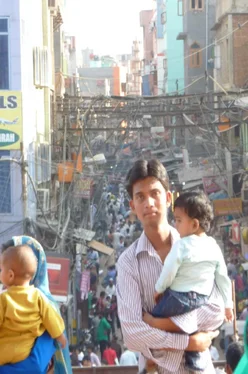
 Akkusationszurückhaltung. Wir werden dargestellt als zufällig hineingeboren in die Welt, als wären wir Produkte einer chemischen Reaktion. Kein Wort über vorgängige generative Entscheidungen oder die Zeugung, die allem Hineingeborenwerden vorangeht.
Akkusationszurückhaltung. Wir werden dargestellt als zufällig hineingeboren in die Welt, als wären wir Produkte einer chemischen Reaktion. Kein Wort über vorgängige generative Entscheidungen oder die Zeugung, die allem Hineingeborenwerden vorangeht.