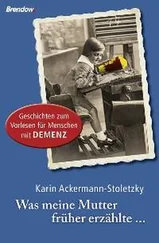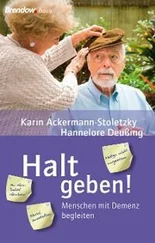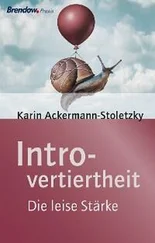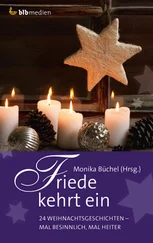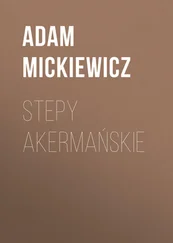Alle Staaten gewähren ihren Bürgern den Spielraum, nicht zu zeugen. Zahlreiche Staaten gestatten es ihren Bürgern, Zeugungen zu revidieren. In letzter Instanz ist die Legitimität der Abtreibung eine staatlich erteilte Lizenz für das Aussterben der Menschheit.
Zudem gilt: Wo mit der Abtreibung die Zerstörung von Embryonen oder die Tötung von Föten zulässig ist, muss die Nichthervorbringung von Menschen – die niemandem schadet – erst recht zulässig sein.
Ganz im Sinne des Prinzips der  Thrakischen Trauer bringt Jandl hier zum Ausdruck: Besser, alles – bereits in utero – hinter sich zu haben als noch vor sich:
Thrakischen Trauer bringt Jandl hier zum Ausdruck: Besser, alles – bereits in utero – hinter sich zu haben als noch vor sich:
„zur abtreibung
lieber gestorben als geboren sein“ (Ernst Jandl, selbstporträt…, S. 35. Fund: GK)
Hier verarbeitet Frisch das Phänomen, dass nicht wenige Mütter für die Dauer ihrer Schwangerschaft von nativistischer Skepsis erfüllt sind und sich eine genuine Mutter-Kind-Bindung erst dann ausbildet, wenn sie das Neugeborene unmittelbar nach der Geburt biopsychisch überwältigt:
„Schwangerschaftsunterbrechung: eine Konsequenz der Kultur, nur der Dschungel gebärt und verwest, wie die Natur will. Der Mensch plant. (…) Wieviele Kinder sind wirklich gewollt? Etwas anderes ist es, dass die Frau eher will, wenn es einmal da ist, Automatismus der Instinkte, sie vergisst, dass sie es hat vermeiden wollen…“ (Frisch, Homo faber, S. 105 und 106)
Diese Mutter-Kind Bindung weist eine Analogie zum  bionomischen Grundsatz auf: Niemand wollte zu existieren beginnen; aber nachdem wir einmal da sind, müssen wir wollen.
bionomischen Grundsatz auf: Niemand wollte zu existieren beginnen; aber nachdem wir einmal da sind, müssen wir wollen.
Ach, wäre ich doch schon geschaffen/geboren
Ein Spiegelbild der Klage „O wär’ ich nicht geboren!“ ist der Ausruf „Ach wär’ ich doch schon geschaffen!“. Soll dieser Ausruf rational sein, so wird vorausgesetzt, dass man seiner eigenen „Erschaffung“ – etwa als unverkörperte Seele – beiwohnen kann. Mithin läuft er dann bloß auf einen Verkörperungswunsch hinaus: „Ach, wäre meine Seele doch schon verkörpert!“ Damit liegt die Erschaffung des Ichkerns, der Seele, aber bereits zurück. Ihrer eigenen Erschaffung könnte keine Seele beiwohnen. Der Wunsch, bereits geschaffen worden zu sein, ist um Größenordnungen irrationaler als die Klage „O wär’ ich nie gezeugt worden!“ Denn hier gibt es ein Ich, das sich in einem  Rücklauf vor die Zeugung als nichtseinwollendes aus der Welt herausreflektiert. Demgegenüber müsste der Ausrufer von „Ach wär’ ich schon geschaffen!“ die eigene Nichtexistenz hintergehen. Von daher fällt es Hegel nachstehend nicht schwer, das gegen ihn vorgebrachte „Argument“ eines Rezensenten abzuwehren, der Mensch sei nicht Herr seines Geborenwerdensollens:
Rücklauf vor die Zeugung als nichtseinwollendes aus der Welt herausreflektiert. Demgegenüber müsste der Ausrufer von „Ach wär’ ich schon geschaffen!“ die eigene Nichtexistenz hintergehen. Von daher fällt es Hegel nachstehend nicht schwer, das gegen ihn vorgebrachte „Argument“ eines Rezensenten abzuwehren, der Mensch sei nicht Herr seines Geborenwerdensollens:
„Nun kommt ein Meisterstück von Widerlegung: »Der Mensch ist nicht Herr darüber, daß er geboren werden soll.« (Gewiß nicht! Aber wenn der Verfasser für nötig findet, diese Gegenrede zu machen, so bringt er den Schein herbei, als ob gesagt worden wäre, daß der Mensch Herr darüber sei, daß er geboren werden solle. Daß es dem Verfasser um diesen Schein ganz wesentlich zu tun sei, dafür zeugt vollends das, was der Verfasser am Schluß seiner Deduktion versichert, daß dieser Satz (von der Möglichkeit, daß der Mensch sich verstümmle, ja töte), »nur aufgestellt ist, um die absolute Kausalität des einzelnen Subjekts zu behaupten«. Referent hat wohl in einer alten Jesuiter- Komödie, »Die Erschaffung der Welt« betitelt, die Vorstellung gesehen, daß Adam vor seiner Erschaffung auftritt und in einer Arie den Wunsch ausspricht, ach wenn er doch schon geschaffen wäre! Aber auch dort ist nicht so weit gegangen, daß Adam als Herr darüber aufgeführt wäre, »ob er geboren werden solle«.“ (Hegel, Rezensionen aus den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, Werke Bd. 11, S. 401f)
Bei Léon Bloy (1846-1917) finden wir in allegorischer Rede die Überzeugung, ausnahmlos alle Kinder verlangten nach dem Geborenwerden, woraus sich – mit Schopenhauer – der ganze Wahnwitz der Liebe erklären lasse: „Ich bin gar nich einmal so weit davon entfernt, mit dem ekelhaften Schopenhauer zu glauben, dass ausnahmslos alle Kinder den Wunsch haben, geboren zu werden, und dass sich auf diese Weise die widersinnigen Wege der Liebe erklären lassen.“{4}
 Hegel
Hegel
Adamitische Daseinsrejektion und Evas Antinatalismus
Schon der erste Mensch wäre lieber unerschaffen geblieben. Einen solchen uranfänglichen Daseinsrejektionismus gestaltet der Dichter John Milton in seinem Epos „Das verlorene Paradies“, in dessen zehntem Buch er seinen Adam gegen Gott klagen lässt: „Bat ich dich etwa, Schöpfer, mich aus Ton / zum Menschen zu gestalten […] Gott schuf mich, ohne dass ich es gewollt.“? (John Milton, Das verlorene Paradies,10. Buch, S. 501) Adams Daseinsrejektion wird von Eva antinatalistisch vollendet, indem sie versucht, Adam zur Kinderlosigkeit zu überreden:
Am meisten schmerzt uns unsrer Kinder Los; / Geboren schon zum Leiden, sollen sie / Des Todes Beute sein! Ja, quälend ist’s, / Sich Ursach wissen von dem Unglückslos / Der eignen Kinder und ein jammervoll / Geschlecht in diese Welt des Fluchs zu setzen, / Das nach den Lebens Elend nur als Fraß / Solch schnödem Ungeheuer dienen soll. / Wohlan, noch steht’s in deiner Macht, noch nicht / Ward dies unselige Geschlecht gezeugt, /Noch bist du kinderlos; bleib kinderlos, / Dann muss der Tod, um seinen Raub betrogen, / Nur an uns beiden sätt’gen seine Gier!“ (A.a.O., S. 513 und 515)
Schnurre, Wolfdietrich (1920–1989)
Im Folgenden denkt Schnurre – ein Mitbegründer der Gruppe 47 – dort weiter, wo John  Milton aufgehört hatte: „Adam, ernst genommen. Und wenn er nun aufbegehrt und sich zum Kampf gestellt hätte? Denn dieser Gott wäre zu überwinden gewesen. Mit Seiner eigenen Fehlkonstruktion: Dem freien Willen. Zu dem auch der freie Wille gehört, über sein eigenes Leben verfügen zu können. Adam hätte sich nur umzubringen brauchen. Von diesem Schlag hätte der Paradiesaustreiber sich so schnell nicht wieder erholt. Schließlich hätte da Adam nicht nur Ihn selber, sondern auch gleich die gesamte Schöpfung verneint. (Was für eine Stümperin doch, diese Schlange.)“ (Der Schattenfotograf, S. 189) Adam hätte nicht unbedingt den Freitod suchen müssen: Um die Schöpfung zu verneinen, hätte es genügt, die Fortzeugung zu verweigern.{5}
Milton aufgehört hatte: „Adam, ernst genommen. Und wenn er nun aufbegehrt und sich zum Kampf gestellt hätte? Denn dieser Gott wäre zu überwinden gewesen. Mit Seiner eigenen Fehlkonstruktion: Dem freien Willen. Zu dem auch der freie Wille gehört, über sein eigenes Leben verfügen zu können. Adam hätte sich nur umzubringen brauchen. Von diesem Schlag hätte der Paradiesaustreiber sich so schnell nicht wieder erholt. Schließlich hätte da Adam nicht nur Ihn selber, sondern auch gleich die gesamte Schöpfung verneint. (Was für eine Stümperin doch, diese Schlange.)“ (Der Schattenfotograf, S. 189) Adam hätte nicht unbedingt den Freitod suchen müssen: Um die Schöpfung zu verneinen, hätte es genügt, die Fortzeugung zu verweigern.{5}
 Freiheit
Freiheit
Eine Kindesadoption birgt ein nativitätskritisches Moment. Denn im Falle einer Adoption wird ein existierendes Kind angenommen und gewollt. Wohingegen beim Entschluss, ein Kind zu zeugen, nur ein elterlicher Wunsch in Erfüllung gehen soll und die Eltern kein bestimmtes Kind annehmen: Die Eltern wollen selbstbezogen ein Kind, nicht aber altruistisch dieses oder jenes Kind annehmen. In mustergültiger Form hat Wolfdietrich Schnurre die moralische Überlegenheit der Adoption zum Ausdruck gebracht:
Читать дальше
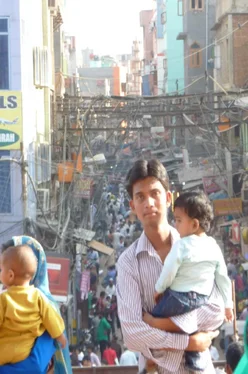
 Thrakischen Trauer bringt Jandl hier zum Ausdruck: Besser, alles – bereits in utero – hinter sich zu haben als noch vor sich:
Thrakischen Trauer bringt Jandl hier zum Ausdruck: Besser, alles – bereits in utero – hinter sich zu haben als noch vor sich: