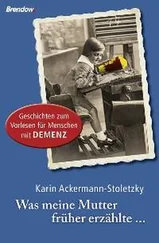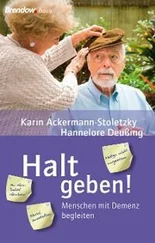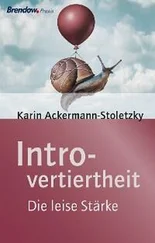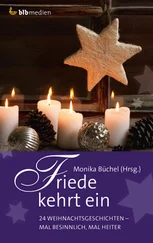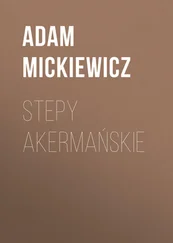Zu den Daseinsverweigerern im Vorhof des Antinatalismus gehören manche Autoren des Absurden. Ist das Dasein absurd, so fragt es sich, warum es man weitere Menschen in es hineinstellen sollte. Zu den Trägern eines verbreiteten Absurditätsverständnisses gehört folgende Stelle aus Camus’ „Der Mythos von Sisyphos“, mit der wir allerdings nicht den Vorhof des Antinatalismus betreten:
„Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus – das ist sehr lange ein bequemer Weg. Eines Tages steht aber das ‚Warum‘ da, und mit diesem Überdruss, in den sich das Erstaunen mischt, fängt alles an. ‚Fängt an‘ – das ist wichtig. Der Überdruss ist das Ende eines mechanischen Lebens, gleichzeitig aber auch der Anfang einer Bewusstseinsregung. Er weckt das Bewusstsein und bereitet den nächsten Schritt vor. Der nächste Schritt ist die unbewusste Umkehr in die Kette oder das endgültige Erwachen. Schließlich führt dieses Erwachen mit der Zeit folgerichtig zu der Lösung: Selbstmord oder Wiederherstellung.“(Camus, Der Mythos von Sisyphos, S. 16f)
Camus‘ suizidales Mittel gegen das Absurde vermag ethisch kaum zu überzeugen: Der Suizid hebt immer nur die eigene Existenz auf, wobei sich der Betreffende längst fortgepflanzt haben kann und insbesondere diese Nachkommen unter dem Freitod eines Elternteils leiden werden. Um es mit dem Absurden ethisch aufzunehmen hätte Camus ins Auge fassen müssen: Einen Austritt aus der Wiederkehr des Absurden in Gestalt der Weigerung, das Absurde fortzupflanzen.
So findet auch die von Camus evozierte Frage nach dem Warum des Absurden eine von ihm nicht bedachte schlichte basale Antwort: Weil wir gezeugt wurden! Urheber des Camusschen Absurden sind die von ihm nicht problematisierten Eltern, die mit jedem Kind die qualvolle Entscheidungsnotwendigkeit zwischen Selbstmord und Wiedereingliederung ins Alltägliche zuallererst hervorbringen. Die vage Anempfehlung des Suizids unter Auslassung der  Elternschuld bei einem maßgeblichen Existenz(!)-Philosophen ist umso problematischer, als Camus sehr wohl weiß, dass unsere vernunftferne Vitalität der Ausführung jedes Suizidwunsches entgegensteht, was er auf folgenden
Elternschuld bei einem maßgeblichen Existenz(!)-Philosophen ist umso problematischer, als Camus sehr wohl weiß, dass unsere vernunftferne Vitalität der Ausführung jedes Suizidwunsches entgegensteht, was er auf folgenden  bionomischen Grundsatz bringt: „In der Bindung des Menschen an sein Leben gibt es etwas, das stärker ist als alles Elend der Welt. Die Entscheidung des Köpers gilt ebensoviel wie eine geistige Entscheidung, und der Körper scheut die Vernichtung. Wir gewöhnen uns ans Leben, ehe wir uns ans Denken gewöhnen.“ (A.a.O., S. 12f) Geradewegs absurd zu nennen ist Camus‘ Versöhnung mit dem Absurden, indem er am Ende seines Essays anregt, Sisyphos als einen glücklichen Menschen zu denken. Damit entschlägt sich Camus jeglichen Einspruchs gegen eine Verlängerung der Generationenkette.
bionomischen Grundsatz bringt: „In der Bindung des Menschen an sein Leben gibt es etwas, das stärker ist als alles Elend der Welt. Die Entscheidung des Köpers gilt ebensoviel wie eine geistige Entscheidung, und der Körper scheut die Vernichtung. Wir gewöhnen uns ans Leben, ehe wir uns ans Denken gewöhnen.“ (A.a.O., S. 12f) Geradewegs absurd zu nennen ist Camus‘ Versöhnung mit dem Absurden, indem er am Ende seines Essays anregt, Sisyphos als einen glücklichen Menschen zu denken. Damit entschlägt sich Camus jeglichen Einspruchs gegen eine Verlängerung der Generationenkette.
Ein Autor des Absurden, der den Vorhof des Antinatalismus betritt, ist Samuel Beckett. Über seine ominöse Figur Godot befragt, äußerte er, er wisse nicht, wer oder was das sei. Häufig wird gesagt, hinter dem Warten auf Godot stehe das unerfüllte und nicht mehr erfüllbare metaphysische Bedürfnis und Sinnverlangen. Setzt man aber für „Godot“ ein: Verkünder der Lehre, dass das absurde Dasein nicht weiterzugeben ist, eröffnen sich Aussichten auf eine kohärente Deutung. In Becketts „Warten auf Godot“ hebt Wladimir zu fragen an: „Wenn wir beiden es bereuen würden?“, und Estragon präzisiert das von Wladimir Unausgesprochene zu: „Dass wir geboren wurden?“ (Beckett, Warten auf Godot, S. 33) Gegen Ende des Stücks scheinen Estragon,Wladimir, Pozzo und Lucky als die letzten ihrer Art die gesamte Menschheit zu repräsentieren. Wladimir sagt zu einem Ausruf Pozzos: „Der Ruf, den wir soeben vernahmen, richtet sich vielmehr an die ganze Menschheit. Aber an dieser Stelle und in diesem Augenblick sind wir die Menschheit, ob es uns passt oder nicht. Wir wollen einmal würdig die Sippschaft vertreten, in die das Missgeschick uns hineingeboren hat.“ (A.a.O., S. 197) Und Pozzo: „…eines Tages wurden wir geboren, eines Tages sterben wir… Sie gebären rittlings über dem Grabe.“ (A.a.O., S. 221) Mit diesem Verweis auf die  Thanatalität spielt Becketts Theater des Absurden tatsächlich in der Nähe zum Antinatalismus: Diffus zeichnet sich die „Godot“ genannt Einsicht ab, dass es moralisch bedenklich ist, Menschen in das Absurde hineinzugebären.
Thanatalität spielt Becketts Theater des Absurden tatsächlich in der Nähe zum Antinatalismus: Diffus zeichnet sich die „Godot“ genannt Einsicht ab, dass es moralisch bedenklich ist, Menschen in das Absurde hineinzugebären.
Abtreibungen sind zugleich Ausdruck und Folge der  Conditio in/humana und stehen in der Fluchtlinie ungewollter Schwangerschaften im Zuge androgener oder biogener
Conditio in/humana und stehen in der Fluchtlinie ungewollter Schwangerschaften im Zuge androgener oder biogener  Vergewaltigung.
Vergewaltigung.
Abtreibung und Nichtexistenzerhellung
Zumal in Zeiten, in denen Abtreibungen legal sind, hätte jeder, der geboren wurde, kurz nach dem  Lebensbeginn ein frühes Ende finden können. Jeder mag sich somit fragen, ob nicht zutrifft: Eine Welt, in der man niemals zu existieren begonnen hätte, ist besser als eine Welt in der man – ein schmerzempfindlicher Fötus – hätte abgetrieben werden können. Bereits der Schauder vor der Abtreibung begründet einen Vorrang des Niedagewesenseins.
Lebensbeginn ein frühes Ende finden können. Jeder mag sich somit fragen, ob nicht zutrifft: Eine Welt, in der man niemals zu existieren begonnen hätte, ist besser als eine Welt in der man – ein schmerzempfindlicher Fötus – hätte abgetrieben werden können. Bereits der Schauder vor der Abtreibung begründet einen Vorrang des Niedagewesenseins.
Abtreibung als Fluchthilfe
In seinem Roman „Zeit der Reife“ kontrastiert Sartre das brutale Geschehen und die erschreckenden Worte um eine Abtreibung mit dem, was bevorsteht, wenn keine Abtreibung vorgenommen wird, sondern das Kind zur Welt kommt:
„Sie sah Matthieu mit verstörten Augen an:
‚Nach der Operation gaben sie mir ein kleines Paket und sagten: Sie werden das in einen Gulli werfen. In einen Gulli. Wie eine tote Ratte. Matthieu!’ Sie drückte heftig seinen Arm: ‚Sie wissen nicht, was Sie da vorhaben.’
‚Und wenn Sie ein Kind in die Welt setzen, wissen Sie’s dann?’, fragte Matthieu zornig.
Ein Kind: ein Bewusstsein mehr, ein kleines betörtes Licht, das im Kreis flöge, sich an den Wänden stieße und nicht mehr entkäme.“ (Sartre, Zeit der Reife, S. 52)
Ganz in der Linie Sartres widmet die Schriftstellerin Esther  Vilar eine Abtreibung zu einer Wohltat um: „Für ihn, den Phantasievollen, Sensiblen ist Schwangerschaftsabbruch fast schon das Gegenteil von Sünde, findet er es doch hundertmal weniger verwerflich, ein befruchtetes Ei zu vernichten, als ein Kind seinem von Tag zu Tag wahrscheinlicher werdenden Strahlentod auszuliefern.“ (Vilar, Die Erziehung der Engel, S. 160)
Vilar eine Abtreibung zu einer Wohltat um: „Für ihn, den Phantasievollen, Sensiblen ist Schwangerschaftsabbruch fast schon das Gegenteil von Sünde, findet er es doch hundertmal weniger verwerflich, ein befruchtetes Ei zu vernichten, als ein Kind seinem von Tag zu Tag wahrscheinlicher werdenden Strahlentod auszuliefern.“ (Vilar, Die Erziehung der Engel, S. 160)
Nicht nur wahrscheinlich, sondern unverbrüchlich ist es, dass wir überhaupt sterben, oftmals ähnlich grauenvoll wie der Strahlenverseuchte. Somit dürfen wir formulieren: Die Zerstörung eines empfindungslosen Embryos ist um Größenordnungen weniger verwerflich, als so zu handeln, dass ein Mensch ausgetragen und dem unabdingbaren Altern, Erkranken, Dahinsiechen und Sterben ausgeliefert wird.
Abtreibung und Aussterben
Читать дальше
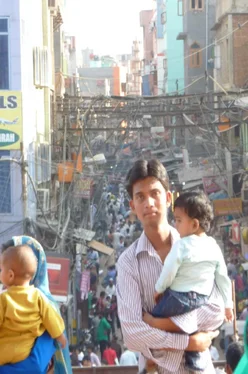
 Elternschuld bei einem maßgeblichen Existenz(!)-Philosophen ist umso problematischer, als Camus sehr wohl weiß, dass unsere vernunftferne Vitalität der Ausführung jedes Suizidwunsches entgegensteht, was er auf folgenden
Elternschuld bei einem maßgeblichen Existenz(!)-Philosophen ist umso problematischer, als Camus sehr wohl weiß, dass unsere vernunftferne Vitalität der Ausführung jedes Suizidwunsches entgegensteht, was er auf folgenden