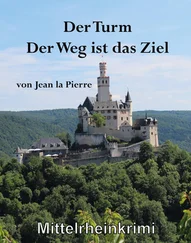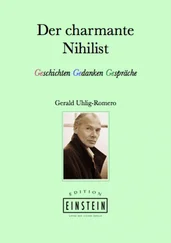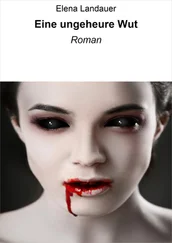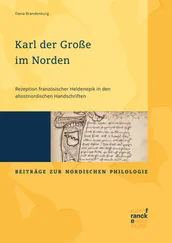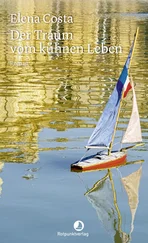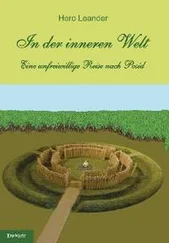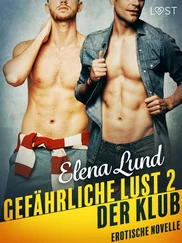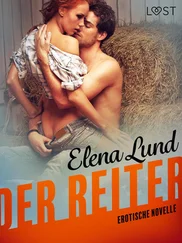So vertraute er denn seiner Oma nach der Lektüre der Heiligenlegende an, er wolle Missionar werden. Seine Oma lobte ihn dafür und ließ gleich seine Mutter kommen, der sie diesen erfreulichen Entschluss mitteilte. Seine lebenskluge Mutter aber zeigte sich skeptisch. Sie fragte ihn, ob er sich das gut überlegt habe. Sie wolle nicht zum Gespött des Dorfes werden, wenn er sich das nach ein paar Wochen oder Jahren anders überlege. Dann aber leitete sie alle erforderlichen Maßnahmen ein. Sie schrieb einen Verwandten an, der Mitglied in einem Missionsorden war und in einem Kloster lebte. Dieser schickte bald den Prospekt einer Klosterschule, die Jugendliche nach der Volksschulzeit aufnahm. Zwar hatte Bertold die Volksschule noch nicht beendet, das fehlende halbe Jahr war aber kein Hindernis. Mit Freude sah Bertold in dem Prospekt der Klosterschule, dass die Jungen dort auch Fußball spielten. Ihm gefiel auch, wie sie über ihren Büchern saßen. Der Verwandte aus dem Missionsorden organisierte die Anmeldung, die Mutter nähte auf alle Kleidungsstücke und Utensilien die von der Schule zugesandten Nummern und Bertold lernte auf Anweisung seiner Mutter das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser auf Latein auswendig. Beides war für ihn kein Problem, da er es oft genug in der Kirche gehört hatte. Auch blieb ihm trotz fehlender Lateinkenntnisse die Bedeutung nicht verborgen, da er die deutsche Übersetzung des Credos und des Paternosters selbst unendlich oft gebetet hatte.
Ich habe in meiner Darstellung von Bertolds Leben mit seiner Kindheit begonnen und werde auch weiter sein Leben in chronologischer Reihenfolge erzählen. Bertolds Darstellung war völlig anders. Er extemporierte sehr gern und überließ es mir, die Dinge in eine zeitliche Ordnung zu bringen. Schließlich würde ich dafür gut bezahlt. Ich war aber weit entfernt davon, ihm den freien Lauf seiner Gedanken zu verbieten. Für mich wurden dadurch die Schwerpunkte deutlich, die sein Denken bestimmten. Ich fragte aber öfter nach: Wieviel Geschwister er gehabt habe, wie das Verhältnis zu seinen Eltern gewesen sei, welche Freunde und Freundinnen er gehabt habe und so weiter. Nur dadurch konnte ich mir ein Bild von seinem Werdegang machen, um letztendlich zu verstehen, warum er sich an Monas Tod schuldig fühlte. Denn davon ging er in seinen Erzählungen immer wieder aus und verlor sich dann in den verschiedensten Phasen seines Lebens.
Nach Ostern 1955 bestiegen Bertold und seine Mutter die örtliche Kleinbahn und machten sich auf den langen Weg zur Klosterschule. Viermal mussten sie umsteigen, bis sie endlich nach der zweihundert Kilometer langen Reise ihr Ziel erreichten. Die Klosterschule lag etwa zwei Kilometer außerhalb der Kleinstadt G. in einem großen Park. Das Gebäude war groß, aber nicht einschüchternd, sondern freundlich und wohlproportioniert und entsprach dem Foto im Prospekt. Nach der Anmeldung beim Rektor des Internats verabschiedete sich die Mutter und machte sich auf den Heimweg. Bertold bekam einen Jungen namens Georg, der aus der gleichen Gegend wie er stammte, als Ansprechpartner zugeteilt. Georg führte ihn im Gebäude und in dem angrenzenden Park herum, zeigte ihm seinen Klassenraum und den Spind im Schlafraum, in dem Bertold seine Sachen unterbringen konnte, und machte ihn mit der Tagesordnung bekannt. Georg, obwohl selbst erst ein Jahr im Internat und kaum zwei Jahre älter als Bertold, erweckte den Eindruck eines alten Hasen, der sich nur widerwillig bereit fand, seine kostbare Zeit mit dem dummen Neuankömmling zu verschwenden. Was er zu erzählen hatte, wirkte lieblos. Die gemeinsame Herkunft, von Bertold angesprochen, interessierte ihn nur insofern, als er seinen Heimatort als viel bedeutsamer als Bertolds Heimatdorf darstellen konnte. Georg sollte Bertold die ersten Wochen bei allen Fragen zur Verfügung stehen. Bertold stellte ihm aber, nachdem die Einführungsrunde beendet war, nie mehr eine Frage, weder an diesem Tag noch in den folgenden Wochen. Er hielt sich lieber an seine neuen Klassenkameraden, die durchweg freundlicher waren und Interessanteres zu berichten hatten. Im Übrigen versuchte er selbst herauszufinden, was zu tun war, weil er nicht als Dummkopf dastehen wollte.
Der Tagesplan sah so aus:
6.30 Uhr: Aufstehen,
7 Uhr: Messe, anschließend Frühstück,
8 Uhr: Unterricht,
13 Uhr: Mittagessen, anschließend Freizeit,
14-16 Uhr: Lernen in der Klasse, anschließend Freizeit,
17 Uhr: freies Lernen in der Klasse,
18 Uhr: Abendessen, anschließend Freizeit,
21 Uhr Bettruhe.
Geschlafen wurde in einem großen Saal, in dem etwa zwanzig Betten standen, die Lazarettbetten ähnelten, vielleicht auch wirklich Lazarettbetten waren. Wenn Bettruhe war, also kurz nach 21 Uhr, kam der Präfekt, sah nach, ob alle ordnungsgemäß in ihren Betten lagen - die Arme mussten auf der Bettdecke liegen, sagte noch einen frommen Spruch, wünschte gute Nacht und machte das Licht aus. Morgens um sechs erschien er wieder mit einer kleinen Glocke in der Hand. Wenn es läutete, musste man sofort aus dem Bett aussteigen, was bei den meisten aber mehr nach einem Aus-dem Bett-Fallen aussah, sich niederknien und mit den Händen auf dem Bett ein kurzes, stilles Morgengebet verrichten. Danach ging es in die vor dem Schlafsaal liegenden Waschräume.
Bertolds Mitschüler in seiner Klasse waren durchweg älter als er. Einige hatten schon eine Berufsausbildung abgeschlossen, einige hatten schon ein paar Jahre auf einer höheren Schule verbracht, nur wenige kamen direkt von der Volksschule. Alle hatten aber schon zu Hause Hochdeutsch gesprochen, eine Sprache, die Bertold nur von der Kirche und der Schule her kannte, wo sich der Lehrer des Hochdeutschen bediente, während die Schüler zwischen Hochdeutsch und dem heimischen Dialekt einen Mittelweg suchten.
Zu seiner Überraschung stellte Bertold fest, dass er in dieser Klosterschule keineswegs zum Missionar ausgebildet wurde und dass auch seine Mutter falsche Vorstellungen gehabt hatte, als sie ihn aufgefordert hatte, schon einmal Credo und Paternoster auswendig zu lernen. Schulisches Ziel der Anstalt war es, die Schüler in sechs Jahren zum Abitur zu führen. Auf diese Art kam Bertold zu einer Ausbildung, die im Dorf für ihn nie in Frage gekommen wäre. Von seinen Freunden war niemand auf eine höhere Schule gegangen. Es wäre als Arroganz und Klassenverrat betrachtet worden, wenn es einer getan hätte. Außerdem kostete die höhere Schule Geld, das seine Eltern nicht hatten. Nur ein paar Kinder aus dem Oberdorf besuchten die Mittelschule in der Kreisstadt. Es waren keineswegs die besten Schüler, aber es waren die Kinder der reicheren Weinhändler, des Lehrers und des Bürgermeisters. Da das Abitur aber die Voraussetzung für die Priesterweihe war, sah sich Bertold zum Klassenverrat berechtigt. Der spielte auch keine so große Rolle mehr, da Bertold weit vom Dorf entfernt war. Er freute sich aber darüber, so die Gelegenheit zu haben, viele Bücher lesen und Dinge lernen zu können, von denen die Dorfbewohner keine Ahnung hatten. Das Glück war seiner jüngsten Schwester Jahre später nicht beschieden, obwohl sie sehr lerneifrig und vermutlich die beste Schülerin war, die jemals die Dorfschule besucht hatte. Sie durfte trotz des heftig geäußerten Wunsches die Mittelschule nicht besuchen, obwohl der Lehrer und der Pfarrer bei den Eltern vorstellig wurden und den Besuch der Mittelschule und gar des Gymnasiums empfahlen. „Dat is nix für unser Leut“, war die Antwort der Mutter, die sich keine Vorstellung davon machen konnte, was ein Mädchen denn mit einer solchen Ausbildung machen sollte. Es würde doch früher oder später heiraten und bis dahin solle es eine ordentliche Lehre machen und etwas Geld für die Aussteuer verdienen.
Bei aller Freude über den Lernstoff, der ihm bevorstand, war Bertold doch beleidigt, als die erste Lektüre angekündigt wurde. Es war das Märchen „Gockel, Hinkel und Gackeleia“ von Clemens Brentano, ein romantisches Märchen mit putzigen Charakteren und einem Ring, der alle Wünsche erfüllte. Nachträglich betrachtete Bertold diese Lektüreauswahl als totalen Fehlgriff des Lehrers, der nicht wusste, was er seinen Schülern vorsetzte. Bertold konnte in diesem Märchen, dessen Sinn sich ihm verschloss, nur unrealistischen Kinderkram sehen. Da war er froh, dass es noch andere Fächer gab, in denen man wirklich etwas lernen konnte: Mathematik, Latein, Geographie und so weiter. Wie schon in der Volksschule fiel ihm das Lernen leicht. Bald zeigte sich, dass seine so viel älteren und lebenserfahreneren Klassenkameraden im Gegensatz zu ihm Schwierigkeiten hatten, sich die lateinischen, griechischen und englischen Vokabeln zu merken, die Grammatik korrekt anzuwenden und die Matheaufgaben zu lösen. Das verhalf ihm zu einigem Ansehen in der Klasse und bei den Lehrern, die ihm immer öfter Mitschüler zur Nachhilfe in Mathematik und Latein zuwiesen.
Читать дальше