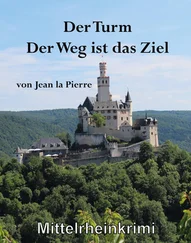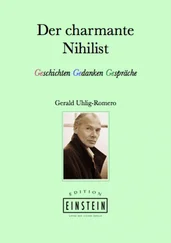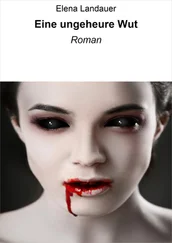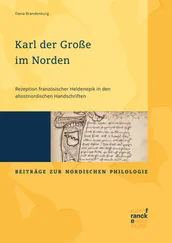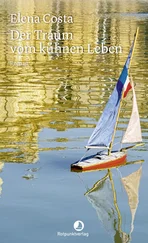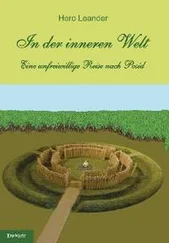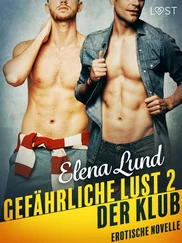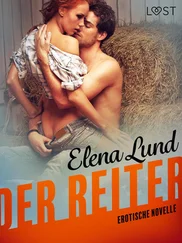Geld gab es kaum. Alle Familien waren weitgehend autark. Die Bauern hatten Kühe für die Feldarbeit, die Milch und die Butter, Schweine für das Fleisch und die Wurst, Hühner für die Eier. In den kleinen Gärten wurde Gemüse angebaut, Obst kam von den Kirsch-, Pflaumen-, Apfel- und Birnbäumen, Getreide von den Feldern, das in der Mühle gegen einen Sack Getreide gemahlen wurde, Dünger lieferte der Misthaufen. Die Betten wurden mit Stroh gestopft. Das Brot backten die Dorfbewohner selbst im Gemeindebackhaus mit ihrem eigenen Mehl. Geld brauchte man nur für Kleidung, Schuhe, Salz, Zucker, Pfeffer und Hefe, Handwerkerrechnungen, Jungschweine und Kunstdünger. Geld kam ab und zu ins Haus, wenn Wein oder ein Stück Vieh verkauft wurde.
Bücher gab es nicht in Bertolds Familie, auch kein Radio und natürlich auch kein Fernsehen, will sagen: Es gab keine mediale Unterhaltung außer dem Bistumsblatt; die Tageszeitung wurde als zu teuer betrachtet. Alles, was man wissen musste, erfuhren die Männer auf der Gemeindeversammlung am Sonntag nach dem Hochamt, die Frauen beim Tratsch mit den Nachbarinnen. Natürlich gab es die Gebetbücher, die Schulbücher, die Heiligenlegende der Oma, aus der ihr jeden Tag die Geschichte des Tagesheiligen vorgelesen wurde, und das Gesundheitsbuch, das Bertold eines Tages tief versteckt im Wäscheschrank fand, als er nach Weihnachtsgebäck suchte. Warum dieses Buch versteckt wurde, war ihm bald klar, als er darin herumblätterte und Beschreibungen und Bilder des Geburtsvorgangs entdeckte. Ein Radio gab es 1954 zur Fußballweltmeisterschaft, ein Jahr bevor Bertold ins Internat ging, den Fernseher erst Anfang der 70er, als seine Eltern schon lange allein wohnten. Als Erwachsener konnte Bertold sich nicht mehr daran erinnern, wie er denn ohne alle Unterhaltungsmedien seine lange Kindheit verbracht hatte. Natürlich gab es morgens die Schule, nachmittags die Arbeit in den Weinbergen und auf den Feldern; aber was er abends getan hatte, besonders an den langen Winterabenden, wusste er nicht. In einigen Erinnerungsfetzen sah er sich zusammen mit dem Rest der Familie beim Splitten der Weidenruten beschäftigt. Diese Weidenruten wurden im Winter aufgespalten, je nach Dicke in zwei oder drei Teile, damit sie im Februar für das Aufbinden der Weinstöcke verwendet werden konnten. Oder er sah sich am Tisch in der kleinen Stube sitzen und Hausaufgaben machen, oder mit seinen Schwestern Mikado spielen oder „Ich seh´etwas, was du nicht siehst“. Nach dem Abendessen brauchte seine Mutter den Tisch zum Bügeln. Da wurde eine Wolldecke auf den Tisch gelegt und darauf dann die Wäsche geplättet. Bei der Bettwäsche durften er und seine Schwestern mithelfen. Die Mutter packte das Betttuch an zwei Spitzen, eines der Kinder an den beiden anderen. Dann wurde gezogen, gezerrt und geschüttelt, wobei sich die kleine Stube als so klein erwies, dass man das Betttuch nur spannen konnte, wenn man die Arme bis an den Körper zog oder einer halb ins nächste Zimmer ging.
Manchmal schauten auch ein Nachbar oder eine Nachbarin vorbei. Dann wurden die Dorfneuigkeiten mitgeteilt und kommentiert, wobei die Kinder nur dann das Wort ergreifen durften, wenn sie wirklich etwas mitzuteilen hatten. In seiner Erinnerung war seine Mutter immer tätig gewesen. Wenn die Wäsche gebügelt war, setzte sie sich zwar hin; aber sie stopfte dann Socken oder strickte Strümpfe oder Pullover. Er konnte sich nicht erinnern, seine Mutter jemals untätig sitzend gesehen zu haben außer am Sonntagnachmittag. In seiner Kindheit hielt er das für die natürlichste Sache der Welt.
Nachträglich wunderte sich Bertold, wie selbstverständlich sich seine Mutter die Fron ständiger Arbeit auferlegt hatte: Sie stand frühmorgens auf, machte das Feuer an, molk die Kühe, ging dann in die Kirche, machte das Frühstück, ging aufs Feld oder in den Weinberg, kam um elf nach Hause, kochte das Essen, ging wieder aufs Feld oder in den Garten, molk die Kühe, bereitete das Abendessen zu und machte dann ihre Bügel- und Strickarbeiten.
Im Sommer war es anders als an den kalten Wintertagen. Da lebte man draußen bis in den späten Abend. Die Eltern standen vor dem Haus und plauschten mit den Dorfbewohnern, die vorbeikamen oder schauten selbst bei Nachbarn vorbei, die ebenso vor ihrem Haus tätig waren. Bertold spielte Fußball. An freien Nachmittagen wurde auf der Wiese unterhalb des Dorfes gespielt, wenn die Zeit knapp war, dienten die Straßen als Spielplatz. Spielbälle waren Konservenbüchsen, mit Stroh ausgestopfte Kuhmägen und Gummibälle, die fast immer beim ersten Kick kaputt gingen. Als Bertold mit zwölf zu Weihnachten einen richtigen Fußball bekam, war er der einzige in der Nachbarschaft, der so etwas besaß. Er freute sich, dadurch im Mittelpunkt zu stehen, nutzte sein Monopol aber auch aus, um andere seine Arbeit machen zu lassen. Bertolds Vater war ein gutmütiger Mensch und ließ mit sich handeln. Wenn wieder einmal langweilige Arbeit anstand, die sich über den ganzen Nachmittag erstrecken sollte, wie Holz sägen oder Unkraut jäten, ließ sich sein Vater auf eine bestimmte Menge festlegen: Wenn dieser oder jener Holzstapel gesägt oder fünf oder sechs Rübenreihen gejätet waren, durfte Bertold Fußball spielen gehen. Wenn andere Jungen dann helfen wollten, um die vereinbarte Arbeit zu erledigen, damit sie endlich mit dem Lederball Fußball spielen konnten, ließ der Vater ihnen die nötigen Arbeitsgeräte zukommen. Gemeinsam erledigten dann die Jungen in einem Tempo, das der Vater nicht für möglich gehalten hatte, die geforderte Arbeit und verschwanden mit Bertold und dem geliebten Ball auf der Fußballwiese.
Nicht nur die Architektur des Dorfes und die Lebensgewohnheiten der Bewohner, auch die religiösen und moralischen Vorstellungen und das Standesdenken waren wie in früheren Jahrhunderten oder in Südeuropa. Alle Dorfbewohner gingen regelmäßig sonntags zur Kirche, viele auch an Werktagen. Alle Eheleute blieben lebenslang zusammen. Sex vor der Ehe war tabu. Wenn das erste Kind kam, wurde fleißig nachgerechnet, ob die Ehefrau vielleicht schon bei der Hochzeit schwanger war. Die Rollenzuteilung für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen wurde streng eingehalten. Die Jungen halfen bei der Feldarbeit, die Mädchen in der Küche. Im Weinberg mussten die Jungen umgraben und Unkraut jäten, die Mädchen die Reben schneiden und binden. Die Jungen sprangen im Sommer in Badehose im Fluss herum, die Mädchen durften nur mit den Füßen ins Wasser, angekleidet. Wenn sie kühn waren, hoben sie dabei den Rock bis zu den Knien. Geheiratet wurde nach Besitzstand: Tausend Stock zu tausend Stock. Heiraten zwischen reich und arm, 2000 Stock und 500 Stock, galten als Mesalliance und wurden entsprechend kommentiert. Heiraten zwischen Katholiken und Protestanten, die gelegentlich durch Kontakte mit evangelischen Dörfern und den beginnenden Tourismus vorkamen, galten als Mischehen. Der Pfarrer führte die Trauung nur durch, wenn der evangelische Teil dem katholischen Zeremoniell zustimmte und versprach, die Kinder katholisch taufen zu lassen und zu erziehen.
Auch Bertolds ältere Schwestern hatten unter den strengen Normen zu leiden. Seine älteste Schwester, die in einem nicht weit entfernten Dorf als Haushaltshilfe arbeitete, hatte auf einer Kirmes einen jungen Mann aus der Kölner Gegend kennen gelernt, der stolzer Besitzer einer 125er DKW war. Mit diesem Motorrad kam er oft an den Wochenenden zu Besuch. Er ließ Bertold auch schon mal auf dem Rücksitz mitfahren und zeigte ihm, dass man damit mehr als hundert Sachen machen konnte. Mit Bertolds Schwester auf dem Sozius fuhr er im Sommerurlaub bis nach Italien.
Ganz plötzlich brach der Kontakt ab. Weder seine Schwester noch ihr Freund tauchten wieder auf. Es hieß, seine Schwester lebe nun auch in der Kölner Gegend. Warum sie aber nie mehr zu Besuch kam, wurde nicht mitgeteilt. In Anwesenheit der Kinder wurde nicht darüber geredet. Erst Jahre später erfuhr Bertold von seiner Schwester, was vorgefallen war. Sie war schwanger geworden. Daraufhin hatte sie geheiratet, niemand aus ihrer Familie hatte an der Hochzeit teilgenommen. Als das Kind kam, lebte sie mit ihrer Tochter bei ihrer zänkischen Schwiegermutter, deren Tochter und deren drei Söhnen in einem winzig kleinen Haus. Sie war total verzweifelt und trug sich mit Selbstmordgedanken. In ihrer Not wandte sie sich an einen in Köln lebenden Verwandten, einen Priester. Dieser schrieb Bertolds Mutter einen Brief, in dem er die Lage ihrer Tochter darstellte und sie aufforderte, wieder Kontakt aufzunehmen. Zwar habe die Tochter gesündigt, sie zu verstoßen, sei aber unchristlich. Noch am selben Tag, an dem Bertolds Mutter den Brief erhielt, schrieb sie ihrer Tochter, sie dürfe wieder nach Hause kommen. Schon wenige Tage später traf die Verstoßene, nun mit Mann und Kind, zu Hause ein. Der Skandal wurde mit keinem Wort erwähnt. Das Verhältnis von Mutter und Tochter war von diesem Tag an bis zum Tod der Mutter gleich bleibend herzlich. Es hatte aber der Rechtfertigung durch einen Priester bedurft, dass die Mutter ihren liebevollen Gefühlen für ihre Tochter nachgeben konnte. Sie kümmerte sich auch nicht um das Gerede im Dorf und nahm die Schande auf sich, eine Tochter zu haben, die vor der Ehe schwanger geworden war.
Читать дальше