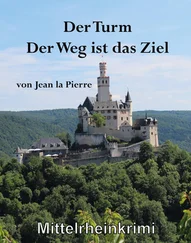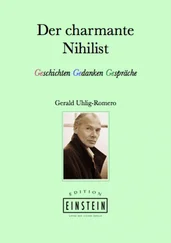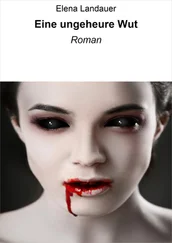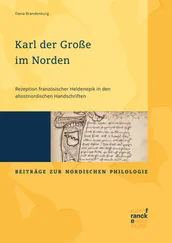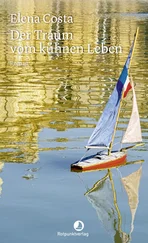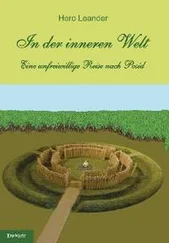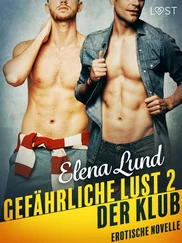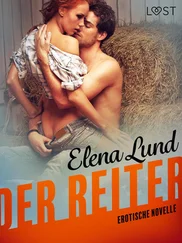Aber man traf sich wieder. „Ich würde gerne mal in Ruhe mit Ihnen einen Kaffee trinken, sagte sie im Vorbeigehen.“ Drei Tage später rief er sie an.
Jetzt war sie tot. Warum konnte er sich nicht verlieben, richtig verlieben? Den Boden unter den Füßen verlieren? Haus und Hof und alles andere, was er hatte und nicht hatte, dieser Frau zu Füßen werfen? Als die Schuldgefühle und die Trauer ihm den Magen zuschnürten, hatte er sich im Telefonbuch eine Psychotherapeutin gesucht, mich. Er wollte einfach nur erzählen. Befreiung von den Schuldgefühlen erhoffte er sich angeblich nicht.
Bertold war in einem sehr kleinen und sehr katholischen Dorf im Rheinland aufgewachsen. An seine Kindheit konnte er sich nur bruchstückhaft erinnern. Sie fiel in die Nachkriegszeit und war von Armut bestimmt. Hauptziel seiner Eltern war, die Familie satt zu bekommen. Er hatte vier Schwestern, zwei ältere und zwei jüngere. Sein Vater hatte die beiden älteren Schwestern mit in die Ehe gebracht. Deren Mutter war bei der Geburt ihres dritten Kindes zusammen mit diesem gestorben. Als Bertold zehn war, bekam er noch einen kleinen Bruder, der allerdings nur ein halbes Jahr lebte. Woran er gestorben war, wusste Bertold nicht. Er erinnerte sich aber genau an die zwiespältigen Gefühle, die er bei der Beerdigung hatte: Einerseits war es traurig, als der kleine weiße Sarg mit seinem Bruder aus dem Haus getragen wurde, andererseits war Bertold auch erleichtert, auch wenn er sich ein bisschen dafür schämte. Denn der Kleine hatte seiner Mutter nicht nur viel Arbeit und Sorgen gemacht, er hatte auch dauernd geschrien. Das Schlimmste aber war, dass seine Mutter ihn Kunibert genannt hatte. So hieß doch keiner im Dorf, außer einem der Dorfdeppen, der zwar offensichtlich fromm war, weil er jeden Sonntag mit schief gelegtem Kopf durch die Kirche zur Kommunion eilte, ansonsten aber ein Depp war. Damit war der Name eine Schande für die Familie, jedenfalls für Bertold, dessen Freunde ihn wegen des Namens seines Bruders aufzogen. Außerdem wohnten im Haus noch seine Oma, die Mutter seiner Mutter, die unter Rheuma litt und, solange er denken konnte, immer in ihrem Zimmer in einem Sessel gesessen hatte, und eine Schwester seiner Oma, Tante Berta, die seit einem Unfall geistesgestört war und alljährlich mindestens einen Selbstmordversuch unternahm, für den sie sich nachher entschuldigte.
Wenn Bertold fünfzig Jahre später an seine Kindheit zurückdachte, kam es ihm vor, als sei er im Mittelalter aufgewachsen. Wenn er einen Film sah, der in alter Zeit auf dem Land spielte, stellte er fest, dass alles fast genau so aussah wie in seiner Kindheit. Die Atmosphäre und die Lebensumstände seiner Kindheit unterschieden sich kaum von den Verhältnissen fünfzig oder fünfhundert Jahre vorher, waren mit den Verhältnissen fünfzig Jahre später aber kaum zu vergleichen. Zwar gab es in seiner Kindheit elektrisches Licht, es gab einige Traktoren und zwei Autos im Dorf, der Rest aber war mittelalterlich. Die Dorfstraßen waren nicht asphaltiert, einige hatten Kopfsteinpflaster, die übrigen waren Schotterstraßen. Die alten Fachwerkhäuser waren so krumm, wie sie vor Jahrhunderten gebaut worden waren. Nur die Kirche und ein paar Häuser oberhalb des Dorfes waren neueren Datums und aus massivem Stein. Vor nahezu jedem Haus war ein Misthaufen mit einer Jauchegrube daneben. Die Jauche wurde im Herbst auf die Felder gebracht. Wenn die Grube vorher voll war, wurde die Jauche auf die Straße gekippt. Sie lief dann durch das Dorf hinunter zum Fluss. Wer keinen Streit mit den Nachbarn haben wollte, leerte die Grube bei Regen. Wenn jemand aber diese Gelegenheit verpasst hatte oder wenn es lange Zeit nicht geregnet hatte, lief die Jauche auch an sonnigen Tagen durch die Straßen und verbreitete, passend zur mittelalterlichen Architektur, mittelalterliches Aroma. Filme, die im Dreißigjährigen Krieg spielten, hätte man ohne künstliche Kulissen im Dorf drehen können.
Und jährlich kam der Fluss, meist im späten Winter zur Zeit der Schneeschmelze, aber auch schon mal im Herbst, wenn es stark regnete, und auch schon mal im Winter, wenn es starken Frost gegeben hatte und der Fluss zugefroren war und sich danach bei Tauwetter die Eisschollen an den Flussengen verkeilten und das Wasser aufstauten. Dann blieb kaum Zeit, Hab und Gut zu retten; sonst ging es ganz langsam, aber unaufhörlich. Das Wasser stieg zehn oder zwanzig Zentimeter die Stunde, aber das tat es ein, zwei oder drei Tage lang. Die Kinder standen in ihren grünen Stiefeln in den Dorfstraßen, markierten den jeweiligen Wasserstand mit Steinen und holten sie wieder aus dem Wasser, um den neuen Wasserstand zu markieren. Die Erwachsenen standen dahinter, schüttelten die Köpfe, erzählten von früheren Überschwemmungen und stellten ihre Mutmaßungen darüber an, wie weit das Wasser diesmal steigen würde. Man war es gewohnt, man nahm es ebenso gefasst wie hilflos. Man schützte, was zu schützen war. In den Kellern wurden die Weinfässer gegen die Kellerdecke abgestützt, damit sie nicht im Keller herumtreiben konnten. Die Lebensmittel, die im Keller gelagert waren, vor allem die Kartoffeln, wurden nach oben oder zu höher wohnenden Verwandten gebracht, ebenso alles, was so herumstand.
Die Keller liefen schon voll, bevor das Wasser die Häuser erreicht hatte. Es sickerte durch die mit Bruchstein gebauten Kellerwände. Es hatte seinen eigenen unterirdischen Weg. Man wusste, wie dieser Weg verlief. Wenn es Bauer A im Keller hatte, wusste Bauer B, dass ihm noch drei oder fünf Stunden blieben, bis das Wasser bei ihm war, und Bauer C konnte auch schon mit dem Aufräumen beginnen.
Aber das Wasser stieg weiter. Es erreichte die ersten Häuser des Dorfes. Sich dagegen mit Sandsäcken zu schützen, war sinnlos, denn das Wasser kam ja von unten aus dem bereits überfluteten Keller. Also zog man um in den ersten Stock, wo dann das Mobiliar zwischen den Betten herumstand. Wenn der Fluss besonders gnadenlos war, reichte das nicht, denn er erreichte in den tiefer gelegenen Häusern auch den ersten Stock. Dann mussten die Betroffenen mit Booten aus ihren Häusern gerettet werden.
Bertolds Elternhaus war das fünfte vom Fluss aus gesehen. Nur alle paar Jahre leckte der Fluss an der Haustür. Der Keller lief aber so gut wie immer voll, oft mehrmals im Jahr. Ein paarmal aber kam der Fluss auch ins Haus. Dann musste auch seine Familie nach oben ziehen. Bertold erinnerte sich, wie er auf der Treppe zum ersten Stock saß und im Wohnzimmer angelte. Es biss aber keiner an. Die Haustür war verschlossen.
Nach der Flut waren die unteren Räume lange Zeit nicht bewohnbar. Als erster Raum wurde die Küche wieder benutzt. Dort brannte dann ständig Feuer im Herd. Wenn das Wetter gut war, wurden alle Fenster und Türen geöffnet, um die Feuchtigkeit aus dem dicken Bruchsteinmauerwerk der Erdgeschossräume herauszubekommen. Neu tapeziert wurde nicht vor Mai, weil die Tapeten vorher von den feuchten Wänden heruntergefallen wären.
Trotzdem wünschte sich Bertold oft, dass die Flut noch höher steigen möge, ebenso wie er sich bei Schneefall wünschte, es möge nicht aufhören zu schneien. Er bewunderte die ungeheure Kraft und Willkür der Natur und war immer etwas enttäuscht, wenn Flut oder Schneefall nachließen.
In den Häusern wurde im Winter nur ein Zimmer beheizt, die „klaa Stuff“, die kleine Stube, zunächst mit einem Holz-, später einem Ölofen. Natürlich war auch die Küche meist warm, wenn dort das Feuer im Herd brannte. Die anderen Zimmer blieben kalt, sowohl die Schlafzimmer, auf deren Scheiben sich morgens, an sehr kalten Tag auch mittags, Eisblumen bildeten, als auch die „good Stuff“, die gute Stube, die nur an Weihnachten und Ostern und, wenn Besuch kam, was fast nur an Weihnachten und Ostern der Fall war, beheizt wurde.
Alle Leute im Dorf waren gleich gekleidet: Die Männer trugen werktags immer einen Blaumann und einen Hut oder eine Mütze, die Frauen lange Röcke und eine Kittelschürze, die Jungen kurze Lederhosen, im Winter darunter Wollstrümpfe, die Mädchen glockige Kleider, die von den älteren an die jüngeren Schwestern weitergegeben wurden. Am Sonntag wurde die Sonntagskleidung angelegt. Die Mädchen trugen bunte Kleider, die kleinen Jungen kurze Stoffhosen, nach der Erstkomunion den Komunionsanzug, der vom örtlichen Schneider immer so großzügig geschnitten wurde, dass er nach Möglichkeit zwei Jahre getragen werden konnte, die Frauen trugen dunkle Kleider, die Männer ihren Hochzeitsanzug, der vielen dreißig Jahre und mehr diente.
Читать дальше