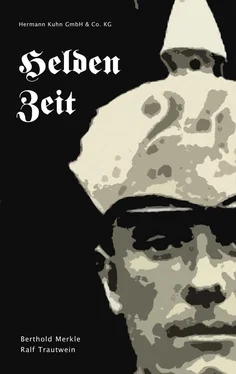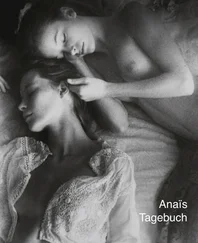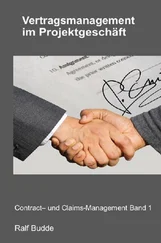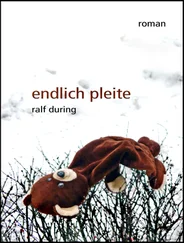Er unternahm einen neuen Versuch. „Eure Hoheit, eine Reise nach Sarajewo wäre nicht nur für Eure Person voller Risiko. Ich bitte zu bedenken: Auch Eure werte Frau Gemahlin könnte Schaden nehmen. Ihr wisst sehr gut: Ich habe den Serben noch nie über den Weg getraut, und ich habe meine guten Gründe dafür. Aber gerade jetzt dürfen wir die Warnungen, die wir bekommen haben, nicht einfach ignorieren.”
Jovan Jovanovic, der serbische Gesandte in Wien, hatte Finanzminister Leon Bilinski aufgesucht und ihm gegenüber Andeutungen gemacht, der Thronfolger könne, sollte er nach Bosnien reisen, in Gefahr geraten. Bilinski hatte sich daraufhin an den Grafen Berchthold gewandt. Berchthold wäre als Außenminister eigentlich erster Ansprechpartner des Gesandten gewesen, doch hielt er wenig von Jovanovic. Berchtold erinnerte sich sehr wohl daran, dass der Serbe nach der Annexion Bosniens durch die Habsburger zu jenen gehört hatte, die Unruhe schürten. Nicht von ungefähr galt Jovanovic als Kandidat der Schwarzen Hand für den Posten des serbischen Außenministers. Mehr als einmal hatte sich Berchthold um die Ablösung dieses feindseligen Diplomaten bemüht; wenn auch vergeblich.
„Schweigt, Conrad.” Franz Ferdinand wischte die Bedenken seines Generals mit einer gebieterischen Handbewegung zur Seite. „Wäre es nach Euch gegangen, so stünden wir schon längst vor Belgrad, wie seinerzeit die Türken vor Wien standen! In nur wenigen Punkten bin ich mir mit meinem Onkel, dem Kaiser, einig. Einer davon ist allerdings die Prämisse, mit den Serben – und damit mit den Russen – keinen Händel anzufangen.”
Conrad von Hötzendorf war kein Zauderer. Ganz gewiss nicht. Entschlusskraft, Tatendrang und unbeugsamer Willen – das waren die Tugenden, die aus seiner Sicht einen Offizier auszeichneten. Am liebsten hätte er schon vor Jahren einen Präventivkrieg gegen die Serben geführt. Der slawische Nationalismus war dem alten General seit jeher ein Dorn im Auge. Den Serben, den Russen und selbst den verbündeten Italienern begegnete er mit Misstrauen. Fünf Jahre war es nun her, dass er Kaiser und Erzherzog fast so weit gehabt hatte, Serbien der Donaumonarchie einzuverleiben. Dass Franz Joseph zumindest kurzzeitig erwogen hatte, diesen Plänen Conrads zu folgen, war freilich nur der damaligen innenpolitischen Lage zuzuschreiben gewesen. Heute sah alles wieder anders aus.
Er ballte die Fäuste. „Mit Verlaub, Majestät – es hätte unserer Monarchie nicht geschadet. Im Gegenteil ...”
„Mein lieber General, ich will nichts mehr davon hören.” Stürgkh und von Krobatin schauten ernst drein. Leon Bilinski hatte eine Leichenbittermiene aufgesetzt. Er fürchtete die Tobsuchtsanfälle des Erzherzogs nicht minder als die meisten anderen Kabinettsmitglieder, und nach Möglichkeit vermied er es, sich den Zorn des künftigen Kaisers zuzuziehen.
„Eure Kaiserliche Hoheit, Ihre Courage wissen wir wohl zu schätzen ...”, begann Karl Stürgkh.
„Jetzt fängt unser Herr Ministerpräsident auch noch zu jammern an”, unterbrach ihn der Erzherzog. „Unser Statthalter Potiorek sitzt nun schon eine ganze Zeit im Konak, meine Herren, und er hat mir berichtet, die Stadt sei sicher. Ärger machen da unten nur ein paar slawische Rotzbuben. Er sagt, die Bosnier erwarten ihren Herrscher. Sie wollen ihren Monarchen erleben, um sich endlich zu besinnen, wohin sie gehören.”
Er legte die Stirn in Falten und schaute in Leopold Graf Berchtolds Richtung. „Uns was meint unser Herr Außenminister?”
Berchtold räusperte sich. „Nun, Kaiserliche Hoheit, ich möchte mich den allgemeinen Bedenken der Herren Kollegen anschließen. Unsere Quellen sind verlässlich, meine ich. Sehr verlässlich, möchte ich sagen. Jovanic ist zwar ein lästiger Aufwiegler. Aber er verfügt – lassen Sie es mich so sagen – über gewisse Beziehungen. Und ich möchte überdies zu bedenken geben, dass die Serben Ihren Besuch in Bosnien auch als Provokation werten könnten.”
„Provokation! Ha!”, rief der Erzherzog empört. „Das ist doch blanker Unsinn! Was redet Ihr da? Wen soll ich provozieren? Ich will niemanden provozieren, auch Belgrad nicht. Das wissen Sie ganz genau, das weiß unser Generalstabschef, und die Serben wissen es auch. Deren Land ist mir völlig egal! Was sollte ich denn mit diesem Serbien überhaupt anfangen?”
Franz Ferdinand hielt einen Augenblick inne, bevor er weitersprach. Er spürte, wie ihn die Wut packte. Die Spannung im Raum stieg. „Gütiger Gott, behüte uns davor, dass wir jemals Serbien annektieren, wie wir es mit Bosnien getan haben! Das war der Alte, der uns Bosnien einverleibt hat! – Was sollte ich wohl mit einem total verschuldeten Land voller Königsmörder und Spitzbuben wollen? Merkt Euch, Conrad: Die Politik, zuzuschauen, wie sich die anderen die Schädel einhauen, ist auf dem Balkan die richtige Politik in diesen Zeiten! Auch wenn Ihr das wahrscheinlich nie begreifen wollt!”
Franz Conrad von Hötzendorf ahnte, warum sich der Thronfolger nicht von seiner Bosnienreise abbringen ließ. Franz Ferdinand wollte offenbar ein Zeichen setzen, sah er in den Slawen doch ein Gegengewicht zu den Ungarn. Er beabsichtigte ganz offensichtlich, wäre er erst einmal Kaiser, sie zur dritten Staatsnation der Habsburger Monarchie zu erheben. Damit würde er, da war sich Conrad mit Außenminister Berchthold einig, den slawischen Nationalisten, hinter denen fraglos russische Interessen standen, den Wind aus den Segeln nehmen. Eine elegante Lösung, musste Conrad zugeben. Wenn die Nationalistenbrut das allerdings genauso sah, und wenn an Jovanovics Warnungen tatsächlich etwas dran war, würde das Leben des Thronfolgers bei einem Besuch in Bosnien durchaus ernsthaft in Gefahr geraten können.
Der alte General seufzte. „Kaiserliche Hoheit, keiner weiß besser als ich, dass Ihr niemanden provozieren wollt.” Er ließ seine Worte für einen Augenblick im Raum stehen. „Ich wünsche Euch Glück. Gott schütze Euch auf dieser Reise!”
SCHWENNINGEN, 28. Juni 1914, 5.45 Uhr. Draußen dämmerte es. Georg hatte nur noch einen Kanten Brot vom Vortag herumliegen, von dem er sich hastig ein Stück abbrach. Außerdem steckte er etwas Käse in die Tasche. Zum Kaffeekochen blieb ihm keine Zeit mehr. Paul hämmerte bereits gegen die Zimmertür. „Los komm endlich”, rief Georgs Vermieter. „Es ist Zeit, du Langschläfer. Wer in der Württembergischen den ganzen Tag Kontrolluhren baut, sollte eigentlich wissen, dass die unbestechlich sind. Du solltest nicht schon wieder zu spät zur Arbeit kommen.”
Georg bewohnte eine kleine Dachkammer im Haus der Links. Bett, Schrank, Stuhl, Tisch – mehr brauchte er nicht. Die meisten Schwenninger Fabrikarbeiter, wie er einer war, wohnten in einfachen Verhältnissen zur Miete. Georg machte das nichts aus. Er brauchte wenig, schließlich hatte er noch keine Familie. Seine Ansprüche beschränkten sich im Wesentlichen auf das, was er am Wochenende im Wirtshaus liegen ließ. Bei Paul war das etwas anderes. Er wurde im nächsten Jahr dreißig, hatte eine Frau, seine beiden Jungs – und eben ein kleines Häuschen. In der Württembergischen war er als gelernter Uhrmacher Georgs Vorarbeiter.
„Nur mit der Ruhe, Paule.”
„Jetzt komm schon, Jockeli. Schlaf nicht wieder ein.”
„Du sollst mich nicht Jockeli nennen.” Georg trat hinaus und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Die beiden Männer stiegen die schmale Holztreppe hinunter. Nicht nur der hagere Paul, der seinen Freund beinahe um Haupteslänge überragte, musste den Kopf einziehen.
„Jockeli” – so hatte ihn Katharina früher genannt. Ob dem Brückle waren sie miteinander aufgewachsen, nur ein paar Häuser voneinander entfernt. Für ihn hatte schon immer festgestanden, dass sie füreinander bestimmt waren. Nach der Volksschule hatte Georg in der Fabrik angefangen, wo immer fleißige Hände gebraucht wurden. Paul Link hatte ihm die Anstellung besorgt. Katharina war bei einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie in Stellung gegangen. Alles war in Ordnung gewesen, bis sie diesem Lehrer über den Weg gelaufen war.
Читать дальше