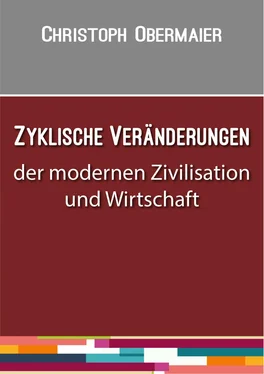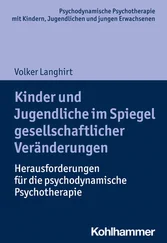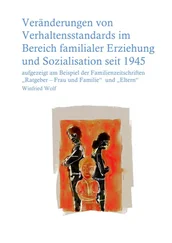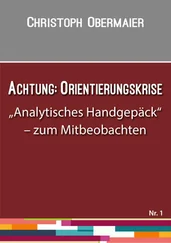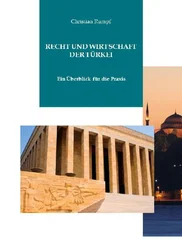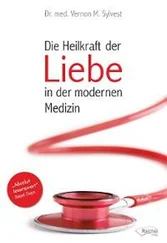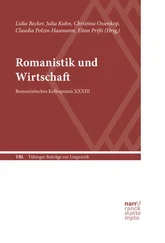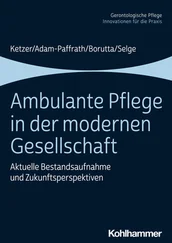0.3. Thesen und Folgerungen
Neue Befunde: Wandel der Zivilisation, des Menschen, seiner Orientierung
Ich fasse dies nochmals thesenartig zusammen: Der entscheidende Befund besteht darin,
dass zeitlich-koextensive – Zyklen in vielen weiteren Zivilisationsbereichen festzumachen sind.
Als dessen Ursache lassen sich Veränderungen unseres kollektiven Menschseins in der westlichen Zivilisation feststellen. – Hinweise auf diesen im Verborgenen wirkenden „Megafaktor“ menschlicher Wandel reichen bis zur beginnenden Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts zurück.
Was den menschlichen Wandel seinerseits auslöst, sind – höchst lapidare, immer gleich strukturierte – Veränderungen unserer Orientierungsgrundlagen: Orientierungszyklen.
Die Wirtschaft ist also in einen umfassenden, zyklisch strukturierten Zivilisationswandel eingebettet. Diese Einbettung ist allerdings differenziert zu beurteilen. Beispielsweise sind Krisenphasen des Menschen gleichzeitig Hochphasen der Innovation – also keineswegs als wirtschaftlich ungünstig einzuschätzen.
Erst die Logik des Orientierungswandels erklärt viele jener Verläufe und Strukturen des Wandels, die uns in so vielen Zivilisationsbereichen begegnen – von der Wirtschaft über die Politik bis zu den Kulturgattungen.
Folgerungen für das Bild der Wirtschaft
Dem Autor entgeht nicht, dass sich damit das Bild der Wirtschaft selbst verändert:
1 Der Prozess der Wirtschaft hat einen hochwirksamen (weil auf das Gesamte der Zivilisation wirkenden) Impulsgeber: den menschlichen Wandel (Orientierungswandel).
2 Und kaum ein anderer Zivilisationsbereich erscheint dessen prägendem Einfluss gegenüber derart offen zu sein wie die Wirtschaft; denn sie ist mit nahezu allen anderen Lebensbereichen vernetzt, ist „multidisziplinär“, ist allen Facetten des Menschseins ausgesetzt.
3 Von hier aus eröffnen sich neue Perspektiven der Erforschung der Konjunkturzyklen. Möglicherweise rücken diese – bislang ein eher randständiges Thema – näher ins Zentrum des Faches.
Damit verbindet sich auch ein prognostischer Wert. Die am Ende dieses E-Books dargestellten Zeittafeln (für die kommenden Jahre wie Dekaden) stellen – wirtschaftsbezogen – Anhaltspunkte zum menschlichen Wandel und Zivilisationswandel zusammen. Sie mögen sowohl zur Orientierung als auch zur kritischen Überprüfung dienen.
Dieser Aufsatz ist insofern der Beginn eines nie endenden Projekts: um die vorgebrachten Modelle mit dem Zukunftsverlauf, so wie er eintritt, abzugleichen. Oder anders gewendet: um diese heranzuziehen, um seine Zeitsituation zu analysieren.
Einleitung Einleitung 0.1. Zur Beobachtung großer Zyklen in der Wirtschaft Dass es im Prozess der Wirtschaft zyklische Veränderungen gibt – und zwar im großen Maßstab, mit Perioden von mehreren Jahrzehnten –, dieser Gedanke wurde erstmals 1926 von Nikolai Kondratieff auf Deutsch publiziert [1], also vor nun 90 Jahren, aber zeitnah auch auf Englisch, Russisch und Französisch [2]. Und bis heute hat er als Diskussionsgegenstand hohe Aktualität, ohne dass jedoch die – zumal prognostische – Belastbarkeit dieser Auffassungen geklärt wäre [3].
1. Kapitel:Zum bisherigen Modell der großen Zyklen in der Wirtschaft und dessen Klärungsbedarf 1. Zum bisherigen Modell der großen Zyklen in der Wirtschaft und dessen Klärungsbedarf 1.1. Zusammengesetzt aus Befunden und Erklärungen Warum kommt es im Wirtschaftsgeschehen zu Einbrüchen, Störungen, Schwankungen? Bis heute wird über die Theorie der großen Konjunkturzyklen diskutiert (der sog. Kondratieff-Zyklen, Kondratieff-Wellen). Demnach gibt es unterschiedlich günstige Zeiten, für die man plastisch die Begriffe „Kondratieff-Sommer“ und „Kondratieff-Winter“ geprägt hat: einen Wechsel von Expansion und Kontraktion. [8]
2. Kapitel:Zyklischer Wandel der menschlichen Orientierung – regelmäßig und machtvoll 2. Zyklischer Wandel der menschlichen Orientierung – regelmäßig und machtvoll Regelmäßiger tiefer Wandel Unsere menschliche Orientierung hat eine ausgeprägt zyklische Komponente, die zivilisationsweit gilt. Mit großer Regelmäßigkeit kommt es zu einschneidenden Veränderungen, die auf den Menschen wie die Zivilisation (mit ihren Bereichen) wirken. – Diese Zusammenhänge erschließen sich nur durch eingehende, spezialisierte Forschungen.
3. Kapitel:Ausstrahlung des menschlichen Wandels auf die Zivilisation und die Wirtschaft Christoph Obermaier
4. Kapitel:Zyklische Einflüsse auf das Wirtschaftsgeschehen Christoph Obermaier
5. Kapitel:Für ein neues Bild unserer Zukunft: Einflüsse auf Zivilisation und Wirtschaft Christoph Obermaier
1. Zum bisherigen Modell der großen Zyklen in der Wirtschaft und dessen Klärungsbedarf
1.1. Zusammengesetzt aus Befunden und Erklärungen
Warum kommt es im Wirtschaftsgeschehen zu Einbrüchen, Störungen, Schwankungen? Bis heute wird über die Theorie der großen Konjunkturzyklen diskutiert (der sog. Kondratieff-Zyklen, Kondratieff-Wellen). Demnach gibt es unterschiedlich günstige Zeiten, für die man plastisch die Begriffe „Kondratieff-Sommer“ und „Kondratieff-Winter“ geprägt hat: einen Wechsel von Expansion und Kontraktion. [8]
Kondratieffs elementare Beobachtungen
Die Theorie der großen Zyklen erhielt ihre Gestalt durch Kondratieff und Schumpeter. Erstmals hatte vor 90 Jahren Nikolai Kondratieff seine Beobachtungen bekannt gemacht: In verschiedenen Aufsätzen (davon zwei auf Deutsch) veröffentlichte er sein seither vieldiskutiertes Konjunkturmodell. [9] Gegründet auf statistische Forschungen, war er zu einem neuen Bild des wirtschaftlichen Prozesses gelangt: Offenbar nimmt dieser keine kontinuierliche Entwicklung; vielmehr vollzieht sich der Konjunkturverlauf in großen Wellen (Zyklen) – mit ungefähr zwei Zyklen je Jahrhundert.
Exkurs: Prognostisch erfolgreich
Diese entdeckte Gesetzmäßigkeit ermöglichte Kondratieff, für die Mitte des 20. Jahrhunderts einen erneuten großen Aufschwung vorherzusagen: einen vierten Zyklus (nach seiner Zählung), wie er tatsächlich eintrat und damit die Prognose in überwältigender Weise bestätigte – man denke an Begriffe wie „Wirtschaftswunder“ und „Golden Age“ (Eric Hobsbawm). Und auch der Abschwung in den 1970ern sowie ein fünfter „Kondratieff“ in den letzten Dekaden des Jahrtausends fügte sich in das Schema der Zyklen ein. [10]
Nikolai Kondratieff, ursprünglich Jurist, hatte in der russischen Revolution kurzzeitig ein hohes Regierungsamt bekleidet und dann ein eigenes Institut zur statistischen Wirtschaftsforschung gegründet. Vergleichende Analysen von Wirtschaftsdaten ab den 1780er Jahren bis in seine Zeit führten ihn zu seiner neuen Theorie: zur Einsicht, dass es zeitlich-großräumige (zyklische) Schwankungen in der kapitalistischen Wirtschaft (der wichtigsten modernen Länder) gibt: lange „Wellen“ der Konjunktur. [11]
Feststellung langer Zyklen (Wellen)
Für Kondratieff stand im Vordergrund, diese Zyklizität zu beweisen bzw. zu erhärten: „Wir betonen, dass wir diesen Regelmäßigkeiten nur empirischen Charakter beilegen und dass wir keineswegs meinen, in ihnen läge eine Erklärung der langen Wellen.“ [12]
Dabei ging er nicht nur ökonometrisch, sondern auch geschichtsanalytisch vor. Der erste Aufsatz (von 1926) vermeidet jede Kausaltheorie – außer in abwehrender Hinsicht. Wie Kondratieff eingehend – und ganz richtig – betonte, spricht der festgefügte zyklische Charakter dagegen, dass zufällige Vorgänge diese konjunkturellen Schwankungen ausgelöst haben könnten. [13] Sie können nicht auf „'äußeren', 'zufälligen', 'episodischen' Ursachen“ [14] beruhen – weder neuen Technologien noch Kriegen und Revolutionen noch Einbeziehungen von Neuländern in die Weltwirtschaft noch der Vergrößerung der Goldgewinnung. [15] –
Читать дальше