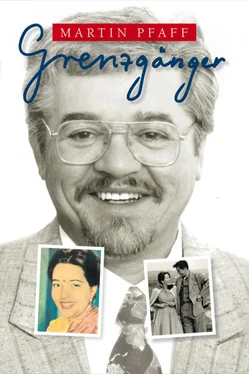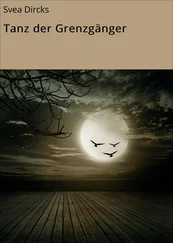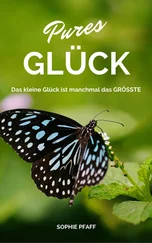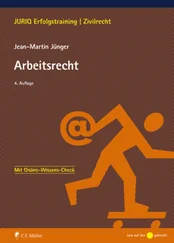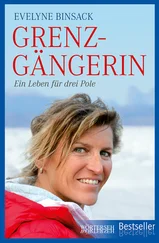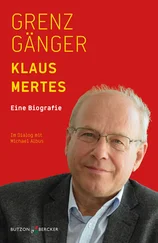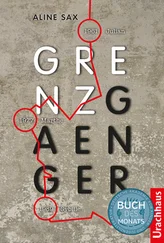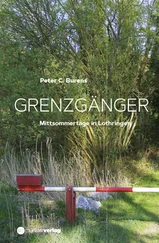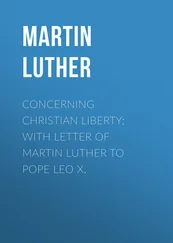Am Montagabend, dem 30. September 1957, erreichten wir Leibnitz. Ich wählte ein komfortabel aussehendes Hotel. Nach dem Essen zog sich Father Abraham zur Nachtruhe zurück, und ich unterhielt mich mit einer jungen Dame, ungefähr in meinem Alter, bis zu später Stunde. Und so kam es, dass ich an diesem Abend im Alter von achtzehneinhalb Jahren „meine Unschuld verlor“ …
Am nächsten Morgen sagte sie beim Abschied: „Glaub ja nicht, dass ich immer so schnell zu haben bin. Bei dir habe ich eine Ausnahme gemacht.“
„Warum?“
„Weil du dem Schauspieler so ähnlich siehst!“
„Welchem Schauspieler?“, fragte ich neugierig.
„Ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern!“
So viel zum Thema Illusionen.
Am nächsten Tag überquerten wir die Grenze nach Jugoslawien. Der Regen trug nicht gerade zur Aufhellung der Stimmung bei, auch nicht die Mienen der Menschen. In mein Tagebuch notierte ich: „Atmosphere dull and people gloomy.“ Der weitere Weg nach Belgrad fand auf einer guten Straße statt, mit wenig Verkehr, aber mit Rindern und Pferden auf der Fahrbahn.
Zu unseren „Ritualen“ des Kennenlernens einer neuen Station auf der Reise gehörte natürlich der Besuch der Heiligen Messe. Ich war sehr beeindruckt von den Gebeten und Gesängen in serbischer Sprache. Ebenso gehörte der Besuch beim Indischen Botschafter zu den Gepflogenheiten Father Abrahams.
Darüber hinaus besuchten wir in Belgrad die in einem Vorort gelegene Blindenschule, sowie ein gewaltiges Monument, an dem Diplomaten bei Ankunft im Land einen Kranz niederlegten, zum Zeichen ihres Respekts vor der Geschichte des Landes.
Nächste Station: Skopje. Wir waren zu Gast beim Erzbischof von Skopje und speisten mit ihm an diesem und am folgenden Tag. Am Morgen besuchten wir den Gottesdienst und danach die Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Ich war aufgeregt, zum ersten Mal eine Moschee – mit Hauptgebäude und Minarett – zu sehen. Erinnerungen an die Reisebeschreibung von Karl May über islamische Länder wurden wach, ein Hauch von Orient und Exotik.
Am Abend waren die Straßen voller Menschen: Das Flanieren zählte wohl zu den wenigen Vergnügungen der Bevölkerung. Die Menschen schienen sehr unglücklich zu sein. Ihre Lebensbedingungen zeigten Armut, Armut, Armut. Ich sah viele Menschen in den Dörfern, die barfuß umhergingen – im Oktober, bei Nässe und Kälte.
Ich war erstaunt, welch leichten Zugang Father Abraham sowohl zu katholischen als auch zu orthodoxen Priestern und Bischöfen hatte – und im weiteren Verlauf unserer Reise noch haben würde. Aber Father lieferte mir, auf meine Frage hin, sehr bald den Grund: „Du musst die Geschichte des Christentums in Indien und insbesondere in der Region Travancore (heute Kerala) kennen, um dies zu verstehen. Das Christentum kam schon im Jahr 52 n. Chr. nach Südindien. Der Apostel Thomas erreichte die Malabar-Küste, um der jüdischen Gemeinde die Botschaft vom Erlöser zu bringen. Schon im Altertum gab es Handel zwischen der Golfregion und Südindien: Mit dem Südwest-Monsun segelten Händler in Richtung Südosten bis an die Malabar-Küste. Mit indischen Handelswaren wie Gewürzen und Textilien und mit dem Nordost-Monsun im Rücken segelten sie dann nach Nordwesten zurück in die Golfregion. Jahrhunderte später kam Thomas der Syrer auf demselben Weg nach Südindien und war äußerst erstaunt, Christen vorzufinden. Diese Christen schlossen sich dann mit der syrisch-orthodoxen Kirche zusammen, deren Oberhaupt – der Patriarchos – im syrischen Homs residiert. Noch heute muss jeder, der Patriarchos werden will, einige Jahre in Südindien verbringen. Denn es gibt mehr Christen der syrisch-orthodoxen Kirche in Indien als in Syrien!“
Ich lauschte gebannt. Father Abraham fuhr fort: „Die syrisch-orthodoxe Kirche ist heute Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in dem vor allem auch die Protestanten vertreten sind. Unter den südindischen Christen gibt es neben Orthodoxen, Katholiken und Protestanten auch einen Zweig der orthodoxen Kirche, der mit Rom uniert ist, also den Papst als Statthalter Christi auf Erden anerkennt. Als südindischer, aber orthodoxer Priester fühle ich mich frei, auf alle Religionsgemeinschaften zuzugehen – ob orthodox, katholisch oder protestantisch!“
Als Zisterzienserzögling war ich verblüfft über diese Flexibilität. Aber mir gefiel diese Offenheit gegenüber allen institutionellen kirchlichen Einrichtungen besser als eine enge Auslegung des christlichen Auftrags. „War Christus denn katholisch?“, fragte ich mich leicht ironisch.
Im Fall von Father Abraham war mir nicht ganz klar, ob er dem jeweiligen kirchlichen Würdenträger die Unterschiede der Institutionen des jetzigen Kerala erläuterte, oder ob er seine Gesprächspartner im Dunkeln ließ, weil er diese Unterschiede als trivial erachtete. Jedenfalls hörte ich seine Predigten in englischer Sprache und war wie alle übrigen Zuhörer fasziniert. Er sprach die Gefühle der Menschen besser an als alle Priester, die ich bisher kennengelernt hatte. Er hatte die Gabe, die Menschen durch sein Wort und seine Persönlichkeit zu begeistern: In seinen Händen wurden sie weich wie Wachs.
Bald merkte ich, dass Father sich dieser Macht durchaus bewusst war. Sein Handeln war also nicht nur von Gottvertrauen, sondern auch von Selbstvertrauen bestimmt: Es würde schon alles gut gehen!
Ein Teil seiner Wirkung war sicher auf sein Charisma zurückzuführen: Hier stand ein blinder Mann, der trotz seines Handicaps durch die Welt reiste. Ein Mann, der für die anderen blinden Menschen seines Landes etwas tun wollte, um ihr Leben zu verbessern. Jemand, den man bewundern konnte! Von Father Abraham erfuhr ich, dass Blindheit in der Regel definiert wird als ein Zustand, in dem ein Mensch nicht normal lesen und schreiben kann. Demnach bedeutet Blindheit nicht zwangsläufig ein totales Fehlen von visueller Wahrnehmung. Father Abraham konnte nicht völlig blind sein. Das wurde mir sehr bald durch zahlreiche Beobachtungen klar. Offensichtlich konnte er einiges wahrnehmen, Konturen, Unterschiede zwischen Licht und Dunkel, die Anwesenheit von Menschen. Wie weit dieses Ausmaß an Sehvermögen ging und ob es konstant war oder von den Umständen abhing, konnte ich nicht feststellen. Ihn zu fragen, oder gar zu hinterfragen, verbot mir der Respekt vor Priestern, den ich durch meine Erziehung in der Klosterschule erlangt hatte.
Die Reise mit dem sehbehinderten Pater änderte einen wesentlichen Faktor: Es war nicht daran zu denken, auf Campingplätzen zu übernachten, schon gar nicht in dem relativ kleinen Zelt. Die Benutzung der Toilette war für Father in einem westlich ausgerichteten Hotel unproblematisch, bei mediterranen Toiletten schon etwas schwieriger, aber bei den primitiven Toiletten auf Campingplätzen undenkbar. Also übernachteten wir fast ausnahmslos in Hotels oder Privathäusern.
Mit der Überquerung der Grenze nach Griechenland kamen wir erneut in ein anderes Land und fühlten uns wie in einer anderen Welt. Es fing an mit der guten Straße und setzte sich fort in den Mienen, der Kleidung und dem Verhalten der Menschen. Hier war ich nun endlich in dem Land, das der westlichen Zivilisation so viel gegeben hatte. Ich dachte an die Jahre des Büffelns der klassischen griechischen Sprache. Damals konnte ich noch längere Passagen der Odyssee aus dem Gedächtnis rezitieren. Noch Jahre später machte ich mir vor größeren Prüfungen oder einem wichtigen Vortrag Mut, indem ich die ersten Verse der Odyssee in meinen Gedanken rezitierte: „Andra moi ennepe Musa, polytropon hos mala pola …“ Damals in Griechenland hatte ich keine Ahnung, dass mein Leben tatsächlich einer Odyssee gleichen würde.
An einem Freitag, dem 11. Oktober 1957, überquerten wir die hohen Berge Nordgriechenlands. Der Anblick des Olymp war beeindruckend. Ich musste unbedingt auf einer kleinen Nebenstraße hinauf zu den Höhen des Olymp, dem Sitz der Götter in der hellenischen Mythologie. Der Weg führte durch eine zerfurchte Landschaft mit Gräben, Schluchten und vielen Felsen. Wir trafen nicht Zeus, den Göttervater, sondern lediglich eine Schafherde mit einem Hirten und dessen Hunden. Der Hirte hatte graue Haare, trug einen Schnurrbart und stützte sich lässig auf einen langen Stab. Seinen gestrickten Pullover verdeckte eine Jacke unbestimmbaren Alters. Die weite Hose konnte ein Erbstück von mehreren Generationen sein. Was beeindruckte, war das seltsam entrückte Lächeln, scheinbar über irdische Probleme erhaben, zufrieden mit sich und der Welt. Hier auf der breiten, steinigen Wiese, mit seiner Herde von hellen und dunklen Schafen und seinen treuen Hunden, hatte er wohl sein Idyll gefunden. Ich konnte keine Flöte entdecken – aber vielleicht war er doch Pan in Verkleidung? Auf solche Gedanken konnte man bei diesem hellblauen Himmel, dem klaren Licht und der kühlen Luft leicht kommen. Selbst seine Hunde waren scheinbar mit sich zufrieden und keineswegs aggressiv.
Читать дальше