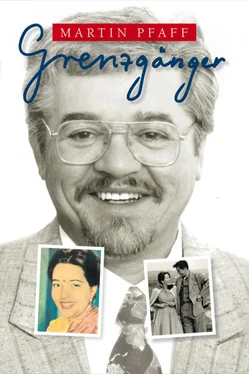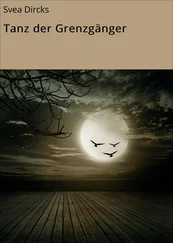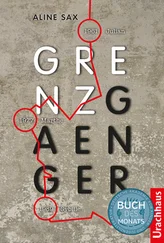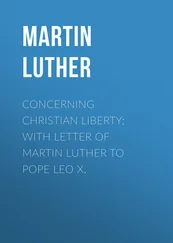Mein Vater gab eine Zollgarantie beim ÖAMTC für mich ab. Ich wurde beim Ergänzungskommando des Österreichischen Bundesheeres in Wien in der Breitenseer Kaserne vorstellig, um meine vorher gegebene Bereitschaft zum freiwilligen Einrücken schon mit achtzehn Jahren zurückzunehmen: Zum Wehrdienst verpflichtet war ich erst mit neunzehn Jahren. Bei der Musterung wurde ich der Infanterie – den Landjägern in Wiener Neustadt – zugeteilt. Einrücken sollte ich am 15. Oktober 1957.
Aber es kam anders als geplant. Vielleicht hielt ein gütiger Schutzengel die Hand über mich? Damals, im Jahr 1957, mussten sich österreichische Staatsbürger für Indien ein Visum in der indischen Gesandtschaft in Wien (erst später wurde es eine Botschaft) ausstellen lassen. Hierfür war die Unterschrift meines Vaters erforderlich, da ich mit achtzehn Jahren noch minderjährig war. Zögerlich leistete mein Vater die Unterschrift auf dem Antragsformular.
Ich reiste am Dienstag, dem 23. Juli 1957, nach Wien, zur indischen Gesandtschaft. „Bitte, warten Sie fünfzehn Minuten! Ihr Visum ist dann fertig.“ Ich nahm auf einem bequemen Stuhl des Wartezimmers Platz. Meine neugierigen Blicke schweiften über die ausgestellten Bilder und Skulpturen aus Indien, die alte Tempel, Monumente und die ewig jungen Berge Indiens darstellten.
„Herr Pfaff, ein indischer Pater hat von Ihnen gehört und möchte gerne mit Ihnen sprechen. Haben Sie etwas dagegen?“, unterbrach der indische Diplomat meine Gedanken.
Ehe ich noch meine Bereitschaft zum Ausdruck bringen konnte, sah ich ihn schon auf mich zukommen: Ein Inder im mittleren Alter, im schwarzen Talar, der ihn als Priester kennzeichnete, von einem Angestellten der Gesandtschaft an der Hand geführt. Ein kaffeebraunes Gesicht mit einem langen schwarzen Vollbart, der ihm eine besondere Würde verlieh. Dunkle Gläser saßen auf einem fein gerundeten Nasenrücken, was ihm ein geheimnisvolles und edles Aussehen gab. Warum wurde er so vorsichtig in den Raum hereingeführt?
„Mein Name ist Father Abraham“, stellte er sich in englischer Sprache vor, mit einer Stimme, die jedermann hätte aufhorchen lassen. Schon beim ersten Treffen fiel mir auf, dass er die Gabe besaß, den Raum mit seiner Persönlichkeit, wie ein Schauspieler auf der Bühne, sofort auszufüllen.
„Martin Pfaff mein Name“, sagte ich aufstehend, etwas mühsam, auf Englisch und schüttelte die dargebotene Hand.
„Ich höre, dass Sie nach Indien fahren wollen“, setzte er fort. „Was wollen Sie dort tun?“
Ich hatte schon von der indischen Offenherzigkeit und regen Anteilnahme am Leben völlig fremder Menschen gehört. „Hauptsächlich will ich Indien sehen … ich habe so viel darüber gelesen. Und dann … ich bin an den indischen Religionen und an indischer Philosophie interessiert …“
„Haben Sie die Absicht, nach Südindien zu gehen?“
„Nein. Ich will nur Nordindien besuchen – Delhi, die Ashrams im Himalaya sowie Kalkutta und Bombay“, erklärte ich.
„Dann versäumen Sie aber viel.“ Sein Begleiter half ihm, in einem der Sessel Platz zu nehmen. Ich setzte mich auch. „Sie dürfen Südindien nicht auslassen! Nicht nur, weil ich aus Südindien komme und meine Heimat in Kerala ist,“ fügte er mit verschmitztem Lächeln hinzu, das alle Anwesenden ansteckte.
„Aber ich habe nicht allzu viel Zeit!“
„Dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass Sie besser gar nicht nach Indien fahren sollten“, entgegnete er lächelnd. „In kurzer Zeit können Sie nicht viel von Indien sehen, noch weniger Indiens Religionen, seine Philosophie und seine Probleme verstehen!“
„Ich muss mich eben damit zufrieden geben!“
„Sie scheinen mir nicht der Mann zu sein, der sich so leicht zufrieden gibt!“ Wieder ein Lächeln. „Ich habe von dem indischen Diplomaten von Ihrer Hartnäckigkeit gehört, mit der Sie ums Visum ansuchten. Und ich habe von Ihren Ideen gehört.“
Allmählich machte mich der Mann wirklich neugierig. „Darf ich wissen, was Sie hierher nach Wien geführt hat?“
Mittlerweile hatte er ein Zigarettenetui aus der Tasche genommen. Er zündete auf ungewöhnliche Weise seine Zigarette an, indem er Zigarette und Zündholz in einer Hand hielt. Den vorstehenden Zündholzkopf strich er an der Zündholzschachtel entlang und sog an der Zigarette, bis das Feuer vom Zündholzkopf das Zigarettenende entflammt hatte.
„Ich will einige Ärzte konsultieren … Ich bin aus Amerika gekommen, wo ich an der Universität Boston studiert habe. Auf meiner Heimreise Richtung Indien war ich in London und Rom. Wissen Sie, Wien ist wegen seiner Ärzte berühmt.“
Er tastete an dem kleinen Teetischchen an seiner Seite herum, ohne hinzusehen. Seine Hand strich über die polierte Oberfläche, bis sie einen Aschenbecher berührte. Er nahm ihn in seine Hand und legte das Zündholz darauf.
Jäh schoss es mir durch den Kopf. War das möglich? Und dann verstand ich auf einmal sein sonderbares Benehmen. „Entschuldigen Sie, Father Abraham, können Sie nicht sehen?“
„Nein,“ sagte er leise, „ich bin sehbehindert …“
Meine lebhafte Neugier schlug in tiefes Mitleid um.
„Seit wann?“
„Seit fünfzehn Jahren … Die Ärzte sagen, es sei ein Hirntumor. Ich habe mich aber nicht unterkriegen lassen!“
„Ja, das sehe ich. Ich hätte es zuerst nicht geglaubt … Aber sagen Sie, wie konnten Sie an einer Universität studieren?“
Er lachte laut: „Das ist gar nicht so schwer: Erstens haben wir das Braillesystem, die Blindenschrift, und können Aufzeichnungen über die Vorlesungen machen. Zweitens haben wir Magnetofone, mit denen wir Vorlesungen festhalten und zu Hause zurückspielen. Junge Leute lesen uns die vorgeschriebenen Bücher vor.“
„Aber wie schreiben Sie denn die Prüfungen?“
„In Amerika sprach ich die Antworten bei den Prüfungen der Universität Boston auf ein Tonband. Dies wurde dann bewertet. Oder ein Schreiber wird uns zur Verfügung gestellt und wir diktieren die Antworten …“
„Ich bin beeindruckt! Wenn all dies möglich ist, kann den Blinden geholfen werden.“
„Nicht nur geholfen“, sagte er mit tiefer Überzeugung. „Die Blinden können Berufe erlernen, ihren Unterhalt verdienen, eine Familie gründen. Kurz und gut, die Blinden können ein völlig normales Leben führen, vorausgesetzt …“
„Was?“
„Vorausgesetzt, dass ihnen die Möglichkeit geboten wird.“
„Ich glaube, dass hier in Österreich, in Deutschland, in England usw. die Regierungen Institute eröffnet haben. Wir in Wien haben einige Schulen. Die Kriegsblinden haben Schulungskurse, und nachher arbeiten sie …“
„Ja, in Europa und in Amerika. Aber im Großteil der Welt, wo es sehr viel mehr Blinde gibt als hier, geschieht fast gar nichts. Es gibt nur wenige Schulen und sehr wenige Ausbildungsmöglichkeiten.“
„Und in Indien?“
„In Indien haben wir über zwei Millionen Blinde. Nicht einmal ein Zehntel hat eine Schulbildung oder Ausbildung, sehr wenige finden eine Anstellung.“
„Aber kann denn gar nichts für sie getan werden? Die Regierung …“
„Indien ist ein Entwicklungsland. Die Regierung hat viele andere Sorgen. Sie muss diesen Menschen zur Hilfe kommen, aber zuerst müssen wir einen Anfang machen. Die Menschen müssen die Regierung erziehen, sie müssen klarmachen, dass die Blinden studieren und arbeiten können. Ich bin von unserer Regierung als Austauschstudent nach Amerika geschickt worden: Ich habe einen Fortgeschrittenenkurs zur Erziehung der Blinden an der Perkins Institution for the Blind bei Boston besucht und zugleich an der Universität Boston studiert. Nun kehre ich nach Indien zurück, um meine weiteren Pläne zu verwirklichen.“
„Ich nehme an, dass Ihnen Ihre Regierung die nötigen Mittel zur Verfügung stellen wird.“
Читать дальше