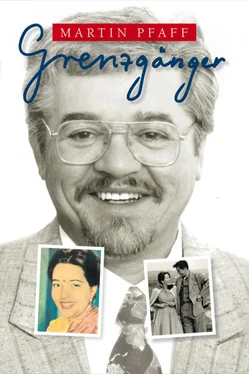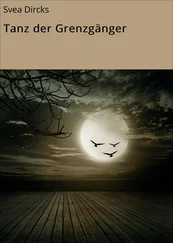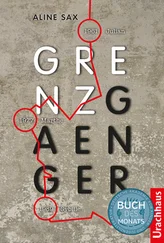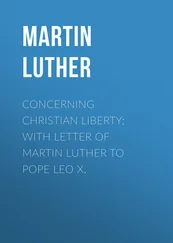Zurück zum Batzenhäusl: Mit meinen Schulkameraden besuchte ich den Tanzkurs beim örtlichen Tanzlehrer. Dieser hatte am Sonntagabend eine zusätzliche Übungszeit vorgesehen, in der man gegen Eintrittsgebühr tanzen konnte. Der Rock‘n’Roll hielt gerade seinen Einzug, nur wurde dieser „sündige Tanz“ nicht in der Tanzstunde unterrichtet. Ich gründete einen informellen „Batzenhäusl Schüler Club“ mit dem erklärten Ziel, am Sonntagabend auch Tänze wie Rock‘n’Roll tanzen zu können. Die Initiative war ein voller Erfolg – vielleicht zu sehr. Dem Tanzlehrer gingen die Schüler am Sonntagabend und somit die Einnahmen aus. Er fand schnell heraus, wer dafür verantwortlich war, und ging zu Direktor Christl. Wie ich später erfahren sollte, fragte der Tanzlehrer, ob man „den Pfaff nicht aus der Schule hinausschmeißen könnte“. Der Direktor verneinte dies mit dem Hinweis, dass Pfaff der beste Schüler sei, den man seit geraumer Zeit gehabt hätte.
Dennoch rief er mich zu sich: „Pfaff, ist Ihnen bewusst, dass es ein Privileg ist, dass Sie als Zugereister überhaupt in einem österreichischen Gymnasium lernen dürfen? Sie sollten sich dankbar verhalten und solche Aktivitäten wie Tanzabende ohne Aufsicht von Erwachsenen unterlassen!“
Ob gerechtfertigt oder nicht: Ich empfand seine Worte als höchst ungerecht. Was konnte ich dafür, dass meine Familie aus Ungarn vertrieben worden war? Und warum sollten ÖJB-Veranstaltungen ohne Aufsicht von Erwachsenen möglich sein, aber Tanzabende nicht? Ich ließ mich nicht von meinen Aktivitäten abbringen, hegte nun aber einen Groll gegenüber dem Tanzlehrer und auch gegenüber Direktor Christl. Jahre später erst, anlässlich eines Klassentreffens, gingen wir beide aufeinander zu und ebneten den Weg für einen freundlichen Umgang.
Ein drittes Beispiel: Bedingt durch meine harte körperliche Arbeit, sowie meine Interessen und Pläne kamen mir viele Aktivitäten der Mitschüler kindisch vor. Ich sagte zu ihnen: „Ihr könnt eure Schlachten mit dem Werfen von Apfelbutzen unter euch austragen. Lasst mich bitte dabei in Ruhe!“ Eines Tages traf mich in der Pause ein Apfelbutzen voll ins Gesicht, während ich im Klassenzimmer saß und las. Aufblickend erkannte ich aus dem hämischen Grinsen meines Mitschülers Gerhard Gruber, dass er der Werfer gewesen sein musste. Ich stand auf und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Dann ging ich in Richtung meines Platzes zurück. Für mich war die Angelegenheit erledigt, weil angemessen: Ohrfeige gegen Apfelbutzen!
Plötzlich riefen mir einige Mitschüler zu: „Pass auf! Dreh dich um!“ Ich tat dies keinen Augenblick zu früh: Mein Kontrahent stand hinter mir, mit verzerrtem Gesicht, einen Sessel hoch erhoben, im Begriff, mir diesen von hinten über den Kopf zu schlagen. Was dann folgte, ging sehr schnell: Ich ergriff mit der linken Hand den Stuhl und zog ihn herunter, seitlich an mir vorbei. Dann folgte ein kurzer Boxkampf – linker Haken, rechte Gerade. Seine Nase war gebrochen und blutete. Ich hatte keineswegs die Absicht gehabt, ihm die Nase zu zertrümmern.
Dies bestätigte die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ans Jugendschöffengericht: „Nunmehr stellte Pfaff seine Angriffe gegen Gruber ein und begab sich auf seinen Sitzplatz zurück. Gruber folgte ihm jedoch in der Absicht, ihn zur Rede zu stellen. Nunmehr trat … [Wolfgang] Dellisch zwischen die beiden Streitenden und eröffnete ihnen, dass er der Schleuderer des Apfelbutzens gewesen sei. Pfaff riet daraufhin dem Gruber, er möge die von ihm erhaltene Ohrfeige an Dellisch weitergeben. Tatsächlich schlug Gruber zu und traf Dellisch ins Gesicht, wodurch dieser eine Schwellung der Oberlippe davontrug.“
Merkwürdigerweise war kein Hinweis auf den beabsichtigten Angriff Grubers mit dem Sessel von hinten oder auf den defensiven Charakter meiner Antwort zu lesen. Wir wurden beide verwarnt, aber nicht verurteilt. Sonst hätte ich als vorbestraft gegolten – mit erheblichen Konsequenzen für meinen weiteren Lebensweg.
Jedenfalls machte mich dies nicht populärer bei den Lehrern, zumal Grubers Vater Lehrer an unserem Gymnasium war. Bei meinen Schulkollegen aber stiegen meine Aktien gewaltig: Hatte ich vorher noch Akzeptanzprobleme bei einigen, weil ich als Quereinsteiger die etablierte Hierarchie infrage stellte, wurde ich fortan als einer der Anführer akzeptiert. Meinem Kontrahenten gegenüber hegte ich jedenfalls keinerlei Groll. Sicher fühlte er sich in seiner Führungsposition herausgefordert und handelte, wie er glaubte, handeln zu müssen.
Im letzten Jahr meines Gymnasiumbesuches wollte ich möglichst schnell einen Führerschein für Motorrad und Auto erwerben. Die Kosten für die praktische Ausbildung waren erheblich. Ich fragte den Fahrlehrer: „Ab wie viel Personen würden Sie einen Rabatt gewähren?“
Seine Antwort: „Ab zehn Personen kann ich einen ordentlichen Nachlass gewähren!“ Also machte ich mich daran, unter meinen Klassenkameraden und deren Verwandten neun weitere Fahrschüler zu finden. Es gelang!
Mein Ziel, nach der Reifeprüfung nach Indien zu fahren, hatte ich fest im Blick. Wenn mich mein Vater nicht zur Mitarbeit im Wald verpflichtete, verwendete ich fast jede freie Minute, um Geld zu verdienen: Ich gab Nachhilfestunden in Latein, Mathematik, Deutsch und Englisch. Bald sprach sich das herum, und ich brauchte mir über Kunden keine Sorgen zu machen. Mit meinem Vater handelte ich aus, dass ich einen Teil der Erlöse aus unserer gemeinsamen Pechertätigkeit für meine Reisepläne verwenden könnte.
Als Hilfsarbeiter am Bau verdiente ich am meisten. Auf dem Bauplatz herrschten raue Sitten: Flasche um Flasche Bier wurde getrunken, schlüpfrige Witze über Frauen erzählt, und der grobschlächtige Polier glänzte durch Herrschaftsgehabe. Über mich, den Gymnasiasten, machte er sich häufig lustig.
Irgendwann war meine Geduld am Ende. Ich weiß nicht, was genau er gesagt hatte, aber ich packte eine leere Bierflasche, schlug an einem Ziegelstein den Boden ab und marschierte, die Flasche wie ein Messer in der Hand, auf ihn zu. Bevor es zu einer Tätlichkeit kommen konnte – und dazu war ich absolut bereit –, rief er mir zu: „Schon gut! Ich wollte dich nur testen! Ich werde keine Witze mehr über dich machen! Versprochen!“ Und von da an war Ruhe auf dem Bauplatz. Dennoch: Stolz bin ich auf diese Geschichte nicht – es hätte auch alles ganz anders ausgehen können!
Zu behaupten, dass meine Eltern entsetzt waren über meine Absicht, auf dem Landweg nach Indien zu fahren, wäre eine Untertreibung. Es spricht für sie, dass sie mir trotz ihrer Ängste keine Hindernisse in den Weg legten.
Mein Plan war im Prinzip einfach: Ich wollte mir ein Motorrad kaufen, auf dem Landweg nach Indien fahren und dort das Motorrad wieder verkaufen, um Mittel für weitere Unternehmungen zu gewinnen.
Heute weiß ich, wie verwegen der Plan war. Das wurde mir so richtig bewusst, als unsere Tochter Maya beschloss, nach dem Abitur ein Jahr lang durch Thailand, Indien, Neuseeland und Australien zu reisen.
Irgendwo las ich damals, dass zwei junge Männer aus Deutschland schon per Motorrad nach Indien gefahren waren. Also musste meine Reise eine größere Herausforderung werden: Es sollte ein Roller sein! Mein Auge war auf einen KTM Mirabell gefallen. Als ich schließlich das Geld zusammenhatte, fuhr ich am 17. Juli 1957 zur KTM-Fabrik nach Mattighofen, um den Roller mit einer Zusatzausrüstung versehen zu lassen, die ihn wüstentauglicher machen sollte.
Ich erinnere mich noch an die staunenden Blicke der KTM-Vertreter: „Muss es unbedingt ein Roller sein? Wäre nicht ein Motorrad – eine Geländemaschine – besser geeignet?“
Doch ich kaufte den Roller, rüstete ihn für die Fahrt aus: ein besonderer Luftfilter gegen den Wüstenstaub, robuste Reifen, ein stärkerer Gepäckträger, ein Auspuffeinsatz zur Lärmdämmung. Außerdem wollte ich einen Satz notwendiger Ersatzteile mitnehmen, zum Beispiel Sicherungen und Kolbenringe. Zudem kaufte ich Packtaschen, ein Zelt, einen Schlafsack und einen Spirituskocher, Geschirr, eine Plastikflasche für Wasser und eine Zeltbeleuchtung. Darüber hinaus investierte ich in einen Sprachführer für Arabisch, Routenpläne und ein Verzeichnis von Campingplätzen.
Читать дальше