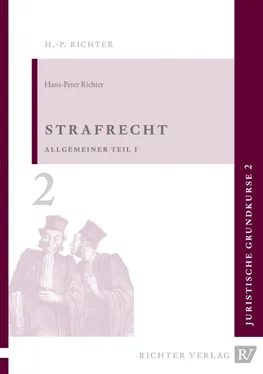Bsp.: Patient P stirbt am ärztlichen Kunstfehler. Er wäre ohnehin eine halbe Stunde später an einer verdorbenen Blutkonserve gestorben.
Da es auf den Erfolg in seiner konkreten Gestalt ankommt, gelangt man unter Anwendung der Conditio-Formel zum Ergebnis, dass ein Hinwegdenken des Kunstfehlers zum Fortfall des Todes durch Kunstfehler führen würde. Der Tod durch eine verdorbene Blutkonserve weist eine andere Gestalt auf und darf daher nicht zur Untersuchung der Kausalität in Betracht gezogen werden.
Alternative Kausalität
Alternative Kausalität bezeichnet Fälle, in denen zwei oder mehrere Kausalverläufe angelegt sind, die alle zum Erfolg führen würden, aber nur allein einer davon den Erfolg verursacht.
Bsp.: A läuft jeden Samstag durch den Wald. Seine Frau pflegt ihm bei der Rückkehr in einem Glas ein erfrischendes Getränk auf der Terrasse bereitzustellen. X schleicht sich an das Glas und schüttet eine tödliche Menge von dem Gift 1 ins Glas. 10 Minuten später tut Y das gleiche, da er von der Tat des X nichts weiß. Jedoch verwendet er das Gift 2, das anders als Gift 1 erst nach Stunden seine tödliche Wirkung entfaltet. A nimmt seinen Erfrischungstrunk und stirbt sofort. - Bis zum Tod des A wirkt hier allein das Gift 1 auf den Körper des A ein. Dieser resorbiert daher nur das Gift von X bis zur tödlichen Grenzmenge und dies ist der Zeitpunkt, den es mit der Conditio-Formel zu untersuchen gilt. Denkt man sich dort das Gift des X weg so entfiele der Erfolg – dass der Tod dennoch durch das Gift des Y eintreten würde, bleibt als unbeachtliche Ersatzursache ohne Bedeutung. Denkt man sich dagegen das Gift des Y weg, so würde das Gift des X dennoch tödlich gewirkt haben. Daher entfiele der Erfolg nicht, also gelangt man zum Ergebnis, dass zwar X, nicht aber Y für den konkreten Tod des A kausal wurde - bei Y bleibt es bei einer versuchten Tat.
Hinweis: die Bezeichnungen Doppelkausalität und Alternative Kausalität werden nicht überall in gleicher Weise verwendet! So werden z.T. beide Fälle gleichgestellt.
Kumulative Kausalität
Kumulative Kausalität bezeichnet Fälle in denen mehrere unabhängig voneinander gesetzte Ursachen erst in ihrem Zusammenwirken gleichzeitig den Erfolg herbeiführen.
Bsp.: A läuft jeden Samstag durch den Wald. Seine Frau pflegt ihm zu seiner Rückkehr in einem Glas ein erfrischendes Getränk auf der Terrasse bereitzustellen. X schleicht sich an das Glas und schüttet eine für sich nicht tödliche Menge Gift ins Glas. 5 Minuten später tut Y das gleiche, da er von der Tat des X nichts weiß. Nachdem sich das Gift aufgelöst hat, nimmt A seinen Erfrischungstrunk und stirbt sofort, da beide Gifte zusammen tödlich wirken. - Bis zum Tod des A wirken beide Giftmengen zusammen auf den Körper des A ein. Dieser resorbiert das Gift beider Täter bis zur tödlichen Grenzmenge und dies ist der Zeitpunkt, den es mit der Conditio-Formel zu untersuchen gilt. Denkt man sich dort das Gift des einen Täters weg, so würde das verbleibende, resorbierte Gift des anderen unter der tödlichen Grenzmenge liegen. Folglich entfiele der Erfolg. Somit gelangt man zum richtigen Ergebnis, dass sowohl X wie Y für den Tod des A kausal wurden.
Wiederholungsfragen zum 1. und 2. Kapitel
32 Fragen
(Um die Antwort zur jeweiligen Frage zu erhalten, blättern Sie eine Seite vor.)
1. Frage:
Wie ist der Prüfungsaufbau gegliedert?
Antwort 1. Frage:
1. Tatbestand
a) objektiver Tatbestand
b) subjektiver Tatbestand
2. Rechtswidrigkeit
3. Schuld
4. Strafe
2. Frage:
Was wird in den Vorschriften des Bes.Teils nur beschrieben?
Antwort 2. Frage:
Meist nur der objektive TB des jeweiligen Delikts, nur ausnahmsweise Rechtswidrigkeit und Vorsatz
3. Frage:
In welchem Umfang ist auf den Punkt „Strafe“ einzugehen?
Antwort 3. Frage:
Nur insoweit, als Strafausschließungs- oder aufhebungsgründe in Frage stehen
4. Frage:
Was bleibt vor allem außer Betracht?
Antwort 4. Frage:
Strafzumessungsfragen
5. Frage:
Welche gedankliche Vorarbeit hat man bei Erstellung des Gutachtens durchzuführen?
Antwort 5. Frage:
1.Erfassung des Sachverhaltes;
2. Erfassen der Fallfrage
3. Aufsuchen der einschlägigen Straftatbestände
6. Frage:
Wie beginnt das Gutachten?
Antwort 6. Frage:
Mit einem Einleitungssatz (Fragestellung)
7. Frage:
Inhalt dieses ersten Satzes?
Antwort 7. Frage:
Täter, in Betracht kommender Straftatbestand und untersuchte Handlung
8. Frage:
Was versteht man unter Subsumtion?
Antwort 8. Frage:
Prüfung, ob ein konkreter Sachverhalt von der abstrakten Norm erfasst wird
9. Frage:
In welche Schritte unterteilt man den Subsumtionsvorgang?
Antwort 9. Frage:
Fragestellung, Definition, Herausarbeitung des Sachverhaltes, Prüfung, ob Sachverhalt Definition ausfüllt, Ergebnis
10. Frage:
Wann ist ein Verhalten tatbestandsmäßig?
Antwort 10. Frage:
Konkrete Umstände entsprechen den abstrakten Merkmalen einer im Gesetz beschriebenen, mit Strafe bedrohten Handlung
11. Frage:
Was ist das wesentliche Element der Erfolgsdelikte?
Antwort 11. Frage:
Der Eintritt eines bestimmten, im Tatbestand näher beschriebenen Erfolges
12. Frage:
Was versteht man unter Kausalität?
Antwort 12. Frage:
Die Abhängigkeit eines Erfolges von einem Verhalten, sog. Ursachenzusammenhang
13. Frage:
Was ist nach der Äquivalenztheorie als Ursache anzusehen?
Antwort 13. Frage:
Jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele.
14. Frage:
Wie sieht die Gedankenoperation aus, die man vornimmt, um festzustellen, ob ein Verhalten kausal i.S.d. Äquivalenztheorie ist?
Antwort 14. Frage:
Man denkt sich das in Frage stehende Verhalten fort und fragt, ob dann auch der Erfolg entfiele. Falls ja, ist Kausalität gegeben.
15. Frage:
Nach welcher anderen Theorie wollen einige Autoren die Kausalität abweichend bestimmen?
Antwort 15. Frage:
Nach der Adäquanztheorie
16. Frage:
Was besagt die Adäquanztheorie?
Antwort 16. Frage:
Ausgehend von der Äquivalenztheorie sollen nur solche Umstände als Ursachen anerkannt werden, die nach allgemeiner Lebenserfahrung dazu geeignet sind, einen derartigen Erfolg herbei zu führen.
17. Frage:
Wie korrigiert man die Weite der Äquivalenztheorie?
Antwort 17. Frage:
Durch die Frage nach der Zurechenbarkeit eines Verhaltens.
18. Frage:
Welche Wege werden im Rahmen der Zurechnung vertreten?
Antwort 18.Frage:
Adäquanztheorie, Relevanztheorie, Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf, Lehre von der objektiven Zurechenbarkeit.
19. Frage:
Was ist hinsichtlich der Adäquanztheorie in diesem Zusammenhang zu merken?
Antwort 19. Frage:
Sie ist keine Zurechnungslehre, sondern eine Kausalitätstheorie.
20. Frage:
Was besagt die Lehre von der objektiven Zurechenbarkeit?
Antwort 20. Frage:
Ein durch menschliches Verhalten verursachter Unrechtserfolg ist nur dann zurechenbar, wenn dieses Verhalten eine rechtlich relevante Gefahr des Erfolgseintritts geschaffen und diese Gefahr sich auch tatsächlich in dem konkreten erfolgsverursachenden Geschehen realisiert hat.
21. Frage:
Wie fasst die Rechtsprechung die Zurechnungsfrage auf?
Antwort 21. Frage:
Als Vorsatzproblem, als Frage der Abweichung des tatsächlichen vom vorgestellten Kausalverlauf.
22. Frage:
Wann ist danach ein Erfolg zurechenbar?
Antwort 22. Frage:
Wenn der tatsächliche Geschehensablauf nur unwesentlich von dem abweicht, den der Täter sich vorgestellt hatte, kann ihm der Erfolg zugerechnet werden.
Читать дальше