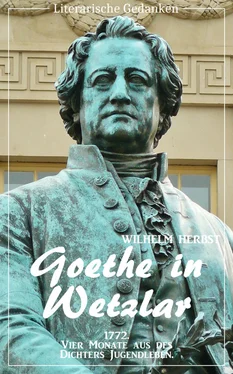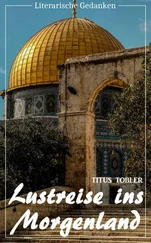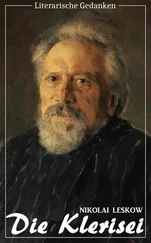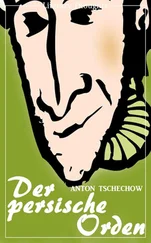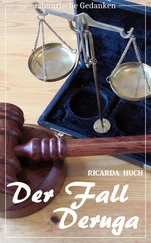Hessische Händel mit der trotzigen Reichsstadt waren nicht neu, schon 1613 überzog der Landgraf mit 10 Fähnlein Fußvolk und 8 Geschützen die Stadt und brachte die widerwillige zum Gehorsam. Eine ähnliche Fehde endete 1763 mit der Eroberung und Besetzung Wetzlars. Die Stadt hatte damals eine Hessische Besatzung von 123 Mann, die mit den Bürgern gemeinsam das Oberthor bewachten und die Ehrenposten am Reichskammergericht stellten. Hessen hatte neben anderen Hoheitsrechten das Geleitsrecht beim Durchzug fremder Truppen. Die reichsfreien Bürger verlangten dies Recht für sich, und so kam es zu wiederholten Zerwürfnissen. Im Jahre 1763 setzten die Bürger ihr Geleitsrecht mit Gewalt durch und entwaffneten die hessischen Truppen; diesem ersten Exzeß folgte wenige Wochen darauf ein zweiter, sogar von einzelnen Ratsherren geschürt, der mit der Flucht der bedrohten Hessen endete. Aber der Tag der Züchtigung kam. Im Mai 1763 setzte sich ein hessisches Kontingent von über 1700 Mann, Fußvolk, Reiterei und Artillerie, in Bewegung, überrumpelte die Stadt in frühester Morgenstunde und zwang den Stadtrat zu der Erklärung, daß künftig der Friede mit dem Schutzherrn erhalten und demselben größere Ehrfurcht erwiesen werden solle. Die Rädelsführer aus der Bürgerschaft, so weit sie nicht entkommen waren, führte man mit gen Gießen, wo einzelne von ihnen Stockhaus und Schanzarbeit erwartete. Nicht einmal die sacrosancten Personen des Kammergerichts wurden respektiert. Einzelne von diesen, die ohne Gruß an den Siegern vorübergingen, erfuhren brutale Behandlung. Bei Kaiser und Reich fand die gedemütigte und gebrandschatzte Stadt kein Gehör. So war es nach innen und außen kein glänzendes und glückliches Bild, das die Reichsstadt, deren Freiheit nicht leben konnte und nicht sterben wollte, damals bot, wenn auch die Friedensjahre nach dem Schluß des siebenjährigen Krieges auch für sie eine Zeit der Erholung waren.
Seinen sozialen Charakter erhielt das damalige Wetzlar durchaus durch das Reichskammergericht. Man sollte nun denken, Reichsstadt und höchstes Reichsgericht, beide wurzelnd in den Traditionen des alten Reiches, hätten sich als zu einander gehörig harmonisch zusammenschließen müssen. Und dies nicht bloß in der Erinnerung an die gemeinsame Wurzel, sondern auch aus dem Triebe der Selbsterhaltung. Denn der ganze Geist der neuen Zeit, der absolute Territorialstaat, von Preußen am glänzendsten vertreten, widerstrebte jenen hinwelkenden Bildungen, die da standen und fielen mit dem Bestande des Reiches. Zunächst aber gehen wir noch nicht ein auf das Reichskammergericht als Rechtsinstitut, vielmehr beschäftigt uns dasselbe hier nur als der sozial in der kleinen Reichsstadt völlig maßgebende Faktor. Denn von den beiden Elementen der Bevölkerung Wetzlars galt nur das reichskammergerichtliche als die eigentliche Gesellschaft. Das Wetzlarer Bürgertum bildete diesem aristokratischen Elemente gegenüber, obwohl es numerisch etwa fünffach überlegen war, doch kein ausreichendes Gegengewicht. Fast wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhielten sich zu einander die beiden Bestandteile. Der Bürger lebte eben gutenteils von dem Verdienste, den ihm die Gerichtszugehörigen zuwandten. Es war viel Geld im Umlauf und schuf den meisten Bürgern ein behagliches Leben; aber von Gewerbfleiß und Unternehmungslust regte sich wenig. Ackerbau, Handwerk und Kleinhandel war der Betrieb der Bürgerschaft, von Großhandel zeigte sich keine Spur; ein Patriziat mit altem Besitz und Namen fehlte, die äußerst wenigen altwetzlarer Patriziergeschlechter, die noch nicht ausgestorben waren, wie die v. Klettenberg, v. Rolshausen, waren nach Franken, nach Frankfurt am Main ausgewandert; das Vermögen der Stadt war gering, die Schulden drückend. War doch gerade die Armut der herabgekommenen Reichsstadt achtzig Jahre zuvor der Grund gewesen, das Reichsgericht zu begehren und aufzunehmen, dessen Aufnahme z.B. von dem reichen bürgerstolzen Frankfurt verweigert worden war. Das Reichskammergericht aber brachte an sich schon ein beträchtliches Kapital in die Stadt. Waren der Kammerrichter und die beiden Präsidenten doch Mitglieder des höchsten Reichsadels, deren fast fürstengleiche Stellung sich auch gesellschaftlich ausprägte. Erschien doch der oberste Gerichtschef wie ein Souverän, wenn er aus seiner Wohnung in der oberen Stadt in der vierspännigen Staatskarosse unter dem Vorritt von Läufern in ihrer theatralischen Tracht mit Kaskett und Knallpeitsche, Schuhen und weißen Strümpfen durch die halsbrechenden Gassen zu dem Gericht fuhr, wo die Supplikanten zu Dutzenden ihre Bittschriften hoch hoben. Ein Palais für den Kammerrichter und die Präsidenten, überhaupt nur eine angemessene Dienstwohnung gab es nicht. Die gesellschaftlichen Repräsentationen der meist an Schlösser und Paläste gewöhnten hohen Herren mußte sich in bescheidenen Miethäusern mit bürgerlicher Enge, Knappheit und Niedrigkeit der Räume behelfen. Trotzdem gab der Adel des Gerichts keinen Titel von seinen Ansprüchen und seiner Exklusivität auf. Die spanische Tracht schon, die an die Stelle der französischen getreten war, hob das Erscheinen der Assessoren ab von ihrer Umgebung. Die Genüsse vornehmer Bewirtung, welche die gerngroße Kleinstadt selbst nicht zum Kaufe bot, wurden von dem unfernen Frankfurt am Main verschrieben, wohin wöchentlich dreimal der Köln-Frankfurter Postwagen und einmal die »Kameral-Kutsche« über unchaussierte Naturstraßen — und nur mit großer Anstrengung in einem Tage — fuhr. Nur wer sich auf Wappen und Adelsbrief berufen konnte, hatte unangefochtenen Zutritt in die erste und eigentliche Gesellschaft. Ja es war eine Form der Einladung, zu manchen Ballfesten jeden Adeligen, aber auch nur diese, zu bitten. Die verletzende Ausweisung eines Bürgerlichen, des jungen Jerusalem, die Goethe im »Werther« als mitwirkendes Motiv seiner Dichtung verwendet hat, wie sie ein Motiv der Zerrüttung und des Untergangs Jerusalems gewesen, haben wir unten noch einmal zu berühren. Das ohnehin schon starke Adelselement des Gerichtes wurde noch verstärkt durch die Mitglieder der großen Kammergerichtsvisitation, die überhaupt zu einer Überfüllung der Stadt führte, durch die jungen Praktikanten und Sollicitanten von Adel und durch den steten und starken Zufluß Durchreisender und durch Besuche bei den Edelleuten des Gerichts. In der That war es in dem engen Reichsstädtchen wie ein buntes Stelldichein aus dem gesamten Reichsadel, der sich wie zu einem großen sozialen Turnier hier traf. Die lässige Bequemlichkeit der Österreicher, die unbequeme Straffheit der Preußen, die einen mit gehobenem Selbstgefühl auf ihren Joseph II., die andern mit trotzigem Stolz auf den großen Friedrich schauend, Katholiken und Protestanten, Norddeutsche und Süddeutsche, alle Schattierungen und Gegensätze trafen sich hier auf schmalstem Raum. Den Österreichern und denen »aus dem Reiche« war dieses Reich noch eine volle Realität, die Norddeutschen sahen mit einer Art Ironie auf die abgelebte Hohlheit der Reichsformen. Zugleich hatte diese Aristokratie des Reichsgerichts gesellige Fühlung mit den kleinen Dynastenhöfen der Nachbarschaft. Es versteht sich, daß die Verkehrssprache der bescheidenen Salons die französische war, der Praktikant wurde zum practicien, und als Visitenkarten dienten meist Spielkarten mit der Aufschrift z.B.
de G.
Assesseur de la Chambre
Impériale et de l'Empire
avec son Epouse.
Natürlich fehlte es dieser sozialen Enge nicht an dem haut goût wuchernder Juden, sittenbedenklicher Häuser. Selbst ein genuesisches Lotto tauchte im Anfang der siebziger Jahre für kurze Zeit auf, dessen Gedächtnis noch lange in dem Namen des »Lottohauses« fortlebte. Italienische und französische Sprachmeister, Tanz- und Fechtlehrer, Perückenmacher, Gold- und Silbersticker und was sonst zum Apparat einer residenzartigen Stadt des vorigen Jahrhunderts gehört, fehlten nicht. Im Sommer boten die meist von vornehmen Kammergerichtsbeamten angelegten und zum Teil ungemein malerischen, mit Landhäusern geschmückten Gärten den aristokratischen Zirkeln die gesellschaftlichen Trefforte. Auch außerhalb der Familie war für mannigfache Lustbarkeit gesorgt. Seit 1768 hatte der Gasthof zum Römischen Kaiser einen stattlichen Saal für Redouten und Konzerte hergestellt, der auch zu theatralischen Aufführungen diente. Der Einzug einer Wandertruppe war auch dem Bürger ein Ereignis, und wenn sie auch nur die Schauerdramen mit Dolch, Gift und Ketten oder schwächliche Rührstücke brachte. Und mochte auch bei diesen die Darstellung in der Regel unter aller Kritik sein, so hat gerade in jenen Jahren (1770/71) doch selbst ein Eckhof es nicht verschmäht, sich mit der Ackermann-Seylerschen Truppe auf diesen Brettern sehen und bewundern zu lassen. Die litterarische Nahrung, so weit es deren bedurfte, bezog das damalige Wetzlar meist von dem nahen Gießen, wo der Universitäts-Buchhändler Joh.Phil. Krieger — ein Kuriosum an Vielseitigkeit, denn er vertrieb neben seinen Büchern mit gleichem Eifer Häringe und Lotterielose, war Pferdeverleiher und Speisewirt — schon 1750 eine Lesebibliothek gegründet hatte, die, nicht sehr gesichtet, deutsches und französisches Lesefutter auch nach Wetzlar hin lieferte. Doch gab es auch in Wetzlar selbst eine Buchhandlung, sogar eine Verlagshandlung und Druckerei von E.G. Winkler, in demselben Hause betrieben, worin sich später der junge Jerusalem erschoß. Daran schloß sich eine Leihbibliothek, die als mumienhafte Antiquität aus der Reichskammergerichtszeit noch weit in dieses Jahrhundert hinein fortmoderte. Sie begann mit Talanders (August Bohses) schlüpfrigen Romanen aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts und zog sich auf gleicher Höhe oder in gleicher Niederung herab bis auf Chr.H. Spieß, Fr. Laun, K.G. Cramer und A. Lafontaine, um endlich des wohlverdienten Todes als Makulatur zu sterben.
Читать дальше