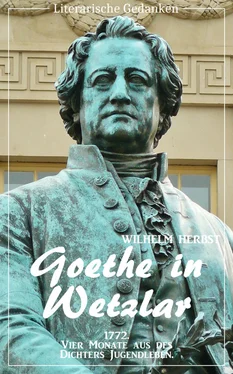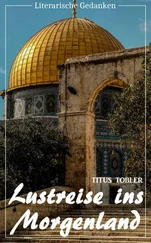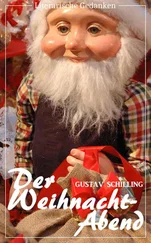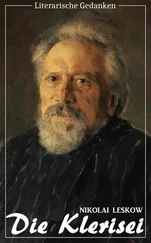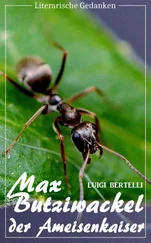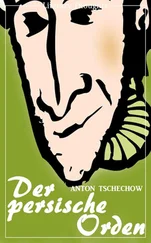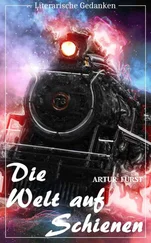Das lebendigste Stück Mittelalter ist aber die alte Reichsstadt selbst, und sie war dies damals noch ganz anders wie heute. Sie ist eine Bergstadt, schiefergedeckt, die Straßen klettern die Höhe hinan, mitunter so steil, daß sich die Gäßchen in Treppen verwandeln. Noch standen damals die Stadtmauern mit ihren sieben Türmen nach der Zahl der sieben alten Zünfte unversehrt; noch wurden die alten Stadtthore von ihren Wächtern, den nicht gar martialischen Stadtsoldaten, gehütet. Die Lahnbrücke trug noch ihre beiden Brückenthore. Zwei Warttürme lagen auf den Höhen zu beiden Seiten der Stadt, deren schmales Gebiet durch eine »Landwehr« zum Schutze gegen rasche Reiterangriffe eingehegt war. Im Inneren gab es wenig von architektonischem Schmuck. Immer wiederkehrende Drangsal im dreißigjährigen Krieg und gleichzeitig (1643) zerstörende Feuersbrunst, in der über siebzig der »fürnehmbsten Häuser abgebronnen« waren, hatten ein gut Teil der baulichen Überlieferung des Mittelalters zerstört. Wohl hatte das Reichskammergericht manchen schmucken Neubau gebracht; das achtzehnte Jahrhundert vornehmlich war die Bauzeit für Wetzlar; aber die stattlichen Häuser der Assessoren und Prokuratoren versteckten sich guten Teils in den Winkeln der Straßen. Vor den Bürgerhäusern lagen noch vielfach Düngerhaufen, Kot, Knochen, Austernschalen, darunter, wie ein zeitgenössischer Beobachter berichtet, »noch vieles aus dem vorigen, d.h. also dem siebzehnten Jahrhundert«; und aus den Drachenköpfen an den Giebeln spieen nicht bloß Regengüsse auf die engen, zum Teil ungepflasterten Gassen und auf die Häupter der Passanten. Die gar gelinde reichsstädtische Polizei war auch in diesem Stück überkonservativ. Es ging das Gerede, in Wetzlar seien die Häuser aus Kot gebaut — und in der That gab es nur einzelne massive Steinbauten —, und die Straßen mit Marmor gepflastert, der vor den Thoren gebrochen wurde. So war das Bild der Stadt nichts weniger als ein erfreuliches, und Goethe hatte recht, wenn er im »Werther« die alte Reichsstadt im Gegensatz zu dem Zauber der umgebenden Natur eine »unangenehme« oder in »Wahrheit und Dichtung« eine »kleine und übelgebaute« nennt. Nur das Zentrum der Reichsstadt, der stolze Dom, überragt nicht bloß durch seine Höhe, sondern nicht minder durch den Wert seiner Architektur die Stadt zu seinen Füßen. Der unvollendete und halbruinenhafte Bau zeigt den ganzen Wechsel der Baustile des Mittelalters vom elften Jahrhundert, in das der Ursprung des »Heidenturms« fällt, bis zum Jahrhundert der Reformation. Ob ihm der Dichter, der sich kurz vorher an Erwin von Steinbach berauscht hatte und bald begeistert davon zeugte, irgendein Interesse abgewonnen, davon findet sich allerdings keine Spur.
Ein Blick auf das innere Leben der Stadt darf hier nicht fehlen; es bildet den Hintergrund für des Dichters poetisches Sommerleben.
Wetzlar gehörte zum oberrheinischen Kreise. Auf dem Regensburger Reichstag nahm es den letzten oder vierzehnten Platz der rheinischen Städtebank ein und folgte nach der Reichsstadt Friedberg, mit welcher es nebst Frankfurt und Gelnhausen den wetterauischen Städtebund bildete. Auch den oberrheinischen Kreistag, der damals meist in Frankfurt am Main zusammentrat, hatte es zu beschicken. Ebenso war die Stadt in der Reichsarmee, und zwar mit einem Kontingente von acht Mann zu Fuß, pflichtmäßig vertreten, und zur Reichs-Operationskasse (den sogen. Römermonaten) steuerte sie nach der Reichsmatrikel 32 Gulden. Freilich eine Macht- und Kraftentfaltung, die uns heute lächeln macht; aber solche Impotenzen gehörten eben untrennbar zum alten und hinwelkenden Reichskörper. Es waren absterbende Glieder, die den Leib nicht zu stärken und zu erhalten vermochten. Die winzige Reichsstadt hatte fast kein Territorium — etwa eine halbe Quadratmeile —, sie war vielmehr eng eingeschränkt von den kleinen, der verrosteten Reichsfreiheit keineswegs holden Nachbarstaaten, der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, den Fürstentümern Nassau-Weilburg und Dillenburg, Solms-Hohensolms und Solms-Braunfels. Von einem seiner Warttürme ließ es sich bequem in vierer Herren Länder schauen. Hatte Wetzlar selbst auch niemals eine große geschichtliche Rolle gespielt noch seiner Kleinheit wegen spielen können, doch führte man mit Stolz die Freiheiten der Reichsstadt auf Kaiser Rotbart zurück, und die Überlieferung von dem Afterkaiser Tilo Kolup, der nach der Sage im »Kaisersgrund« sollte gerichtet worden sein, leben noch heute in der Bürgerschaft fort.
Das war Romantik gegenüber der gesunkenen Gegenwart. Die Stadt hatte ihr reichliches Teil an der Fäulnis und Misère, die damals auf allen, zumal den kleinen Reichsstädten lag. Sie waren nur Städte geblieben, als ringsum sich Staaten bildeten, und konnten nur, indem sie wieder Glieder von Staaten wurden, aus der höheren Einheit neues Leben gewinnen. Verarmt, zerrüttet, der eigenen Lebenskraft entbehrend, hatte auch Wetzlar keinen Weg, sich aus sich selbst zu erheben.
Die eingeborene Bürgerschaft, die noch nicht 5000 Köpfe zählte, wurde durch die zugewanderte Bevölkerung des Kammergerichts von etwa 900 Personen durch Besitz, Rang, Bildung, soziale Ansprüche überschattet.
Die mittleren Klassen des Wetzlarer Bürgertums zeigten sich im Gefühl ihrer Abhängigkeit vom Reichskammergericht fügsam und rücksichtsvoll gegen die Wünsche und Ansprüche dieses dominierenden Elementes. Anders stand es mit den unteren Volksschichten, die zwar auch gutenteils ihre Nahrung von jenen höheren Regionen bezogen, denen aber die Bildung und der Überblick abgingen, um deshalb besondere Rücksicht zu nehmen. Überhaupt lag in dem reichsstädtischen Pöbel auch hier ein starker Rest von Trotz und stolzem Selbstgefühl. Die reichsstädtische Polizei ermangelte, wie in fast allen Reichsstädten, der Autorität; das eigene Militär — und welches Militär! — war aus der Bürgerschaft hervorgegangen und darum wenig gefürchtet; das hessische Kontingent aber, das in der Stadt lag, war allezeit ein Gegenstand der Opposition oder der Antipathie für die Gesamtbürgerschaft. Aber auch die städtische Obrigkeit — die beiden Bürgermeister, die Ratsschöffen und Ratsherren — besaß keine durchgreifende Autorität. Gewaltthaten gegen den Stadtrat kamen nicht selten vor. Die Justiz war ohne Kraft. Die Stadt besaß ein Zucht- und Korrektionshaus; man entledigte sich der Verbrecher möglichst bald durch Überlassung an die fremden Werber. Namentlich waren es zwei Punkte, gegen welche sich die Widerstandslust der niederen Volksschichten Wetzlars wiederholt aufbäumte: das unbedingtere Hervortreten des Katholicismus und die Hoheits- und Vogteirechte (seit 1536) des Landgrafen von Hessen.
Wetzlar war (seit 1542) eine streng protestantische Stadt. Die Bürgerschaft wachte eifrig und eifersüchtig über diesen ihren Charakter. Ja sie war wiederholt, während des Abfalles der Niederlande im sechzehnten (1586) und nach Aufhebung des Edikts von Nantes im siebzehnten Jahrhundert, eine Freistatt für niederländische und französische Flüchtlinge geworden. Nun lag es aber in der Natur der Dinge, daß, seitdem die Reichsstadt das Reichskammergericht herbergte, die Forderung der Parität und Kultusfreiheit sich auch zugunsten der Katholiken gebieterisch geltend machen mußte. Das katholische Element erhob stärker das Haupt. Schon bei dem Einzug des Gerichts wurden nicht ohne anfänglichen Widerstand des Stadtrats Bedingungen derart gestellt und schließlich (1692) bewilligt. Und gerade die katholischen Mitglieder des Gerichts, der Chef als der richterliche Vertreter kaiserlicher Majestät an der Spitze, traten durch Rang und Reichtum hervor. Der katholische Gottesdienst fand, wie noch heute, im Chor des Doms statt, wo, um alle Kollisionen zu vermeiden, die Uhren aufgehalten wurden. Auch ein Kloster bestand in Wetzlar selbst und zwar gesetzwidrig, da im Normaljahr 1624 sich noch keine Klöster in Wetzlar fanden. Auch die Jesuiten fehlten nicht; sie hatten ein Kollegium und die gelehrte Schule der Stadt. Doch alles dies ließ sich die Bürgerschaft, da sie es nicht ändern konnte, gefallen. Da aber die Katholiken, auf Grund allerdings des ursprünglichen Abkommens von 1692 und getrieben von jesuitischen Einflüssen, einen Schritt weiter thaten und im Frühjahr 1770 zur Feier der Papstwahl Klemens' XIV. und des von diesem angeordneten Jubiläums wiederholt Prozessionen in Scene setzten, ohne sich auch dabei an die gezogenen Grenzen zu halten, da brach der Unwille des Volkes los, es setzte Schläge und Rauferei, der die Stadtsoldaten und die hessische Besatzung steuern mußten. Die Bürgerschaft hatte das Gefühl, nicht mehr Herr zu sein im eigenen Hause. Kriegerischer als diese Religionskriege en miniature sah der hessische Krieg gegen Wetzlar vom Jahre 1763 aus; an Tragikomik jenem Wasunger Krieg nicht unähnlich, gleich nach dem Ausgang des siebenjährigen, in welchem die hessischen Truppen, namentlich bei Roßbach, keine Lorbeeren erkämpft hatten.
Читать дальше