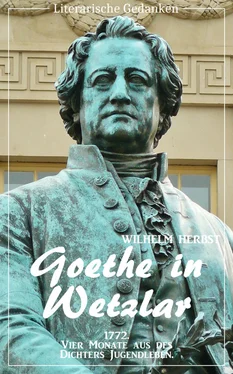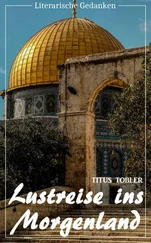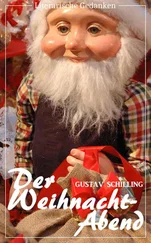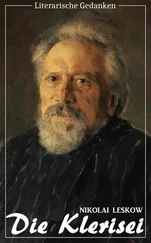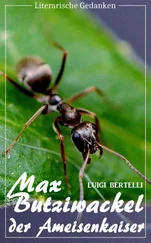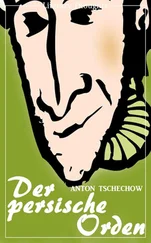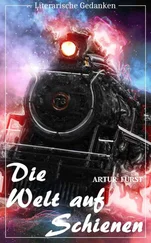Dann stehen wir vor der zweiten Frage, wie d.h. in welchem Stadium seines menschlichen und poetischen Werdens der junge Dichter in die neuen Verhältnisse eintrat. Die Antwort auf diese Frage stellt den Anschluß dieses Abschnitts an die nächste Vergangenheit her, und es ist natürlich, daß wir Goethe in Wetzlar und das, was ihm dieser Aufenthalt eingebracht, erst dann verstehen, wenn wir wissen, was er mitgebracht. Freilich liegt eine volle Antwort auf diese Frage in der ganzen Vorgeschichte, in der genetischen Entwickelung, auf die wir hier verzichten müssen. Nur mit kurzen Strichen kann das Bild des Dichters im Frühjahr 1772 gezeichnet werden.
Wir erinnern uns daran, daß Goethe menschlich und poetisch in Straßburg eigentlich aufzuleben begonnen hat. Was weiter zurücklag, namentlich die Leipziger Zeit, zeigt mehr eine Verhüllung als eine Entfaltung des wahren Goethe. Sind doch die Jugenddramen, die »Mitschuldigen« und die »Launen des Verliebten« nach Art und Geist so grundverschieden von den poetischen Früchten, die in Straßburg und Frankfurt reifen oder ansetzen, als ob es Kinder verschiedener Väter wären. In der Straßburger Zeit hat vor allem Herders überwältigende Einwirkung und die Liebe zu Friederike herausgebildet, was in dem Jüngling schlummerte. Man hat die Folgejahre wohl Goethes deutsche Periode genannt. Und sie war es, wenn man auch richtiger den allgemeineren und umfassenderen Namen »germanische« Periode wählen sollte, womit neben dem hervorbrechenden Eigenen auch die mitwirkenden Kräfte von außen, Shakespeare und Ossian und der englische Roman bezeichnet würden. Und alle diese Hilfskräfte von außen vertritt dem ahnenden und suchenden Dichter Herders entscheidender Rat; und hinter Herder und von diesem dem Dichter nahe gerückt steht die sibyllinische Weisheit des nie gesehenen Magus im Norden. Aber derselbe Herder wird ihm auch zum Vertreter der Antike, der hellenischen Dichtung. Und wenn die in Straßburg beginnende Homerlektüre und die Erweiterung seiner griechischen Studien in Frankfurt und Wetzlar auch nicht unmittelbare Früchte reifen, die jener deutschen Periode alsbald eine klassische gegenüberstellten, so sieht doch jede schärfere Betrachtung, daß die Reaktion griechischer Einfalt und Plastik gegen ungefüge germanische Formlosigkeit alsbald und lange vor »Iphigenia«, »Tasso« und »Hermann und Dorothea« hervorscheint. Gewiß nur als ein edles naturverwandtes Pfropfreis, nicht als ein Fremdes und Aufgedrungenes. Denn Goethes schlichtem Naturgefühl kam die Antike nur bestätigend, fördernd entgegen. Selbst in den bewegtesten Teilen des »Werther« erkennen wir den besonnenen Zügel des Künstlers, der das Gesetz der Harmonie in sich trägt. Es ist, als ob die Motive der deutschen Renaissancezeit schon in dem jungen Goethe mit ursprünglicher Kraft wiederkehrten. In ihm vertrug sich das scheinbar Fernste hellenischer Poesie, das er sich mit wunderbarer Aneignungskraft zu eigen machte, mit dem von Natur Nächsten, Vaterländischen.
Nach Frankfurt von der Universitätszeit heimgekehrt, geht Goethe sofort zur praktischen Anwendung des in Straßburg Erlebten und Erlernten über. Gleichzeitig tritt er ein Amt an und versucht zum erstenmale den höheren dramatischen Flug. »Götz« und die Advokatur gehen im ersten Quartal des Winters von 1771 auf 1772 neben einander her. Es sind die Konsequenzen und Fortwirkungen der Straßburger Zeit. In dem zweiten Quartal aber dieses merkwürdigen Winters vertieft er sich in die griechischen Studien und tritt zugleich in jenen Darmstadt-Homburger Kreis ein, der ihm menschlich so ungemein viel wurde. Man darf sagen: es waren bei seinem Eintritt in Wetzlar fast alle Elemente zusammen, die den Dichter gründeten und bedingten; in Wetzlar selbst wurden diese Elemente ergänzt und vervollständigt. Und dabei bedeutet der Zeitpunkt jene fesselnde Lage unmittelbar vor dem Aufthun der Schranken, aus denen er zu poetischen Großthaten in die weite Arena unserer Litteratur hervortreten sollte. Wohl war man schon aufmerksam auf den Dichterjüngling in engeren Kreisen, aber nach außen hin war er ein noch unberühmter Name. Er selbst aber glaubte an seinen Beruf von Gottes Gnaden und er führte in dem ersten noch unfertigen Entwurf des »Götz«, den nur wenige kannten, sein Probe-, wenn auch noch nicht sein Meisterstück mit nach Wetzlar. So war es ein eigener Mittelzustand zwischen glücklicher Verborgenheit, welche hinter den Coulissen der großen Welt die volle Unbefangenheit zuließ, und den inneren Ansprüchen einer genialen Natur, die ihrer selbst gewiß geworden war. Ein litterarisches Inkognito, aber mit erprobtem Kraftgefühl und poetischer Legitimation, die sich noch steigerte durch die Mitwirkung an dem nun auftauchenden und den neuen Geist verkündenden kritischen Institut der Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Und für dieses große Streben war es charakteristisch, daß der Dichter wie instinktiv damals nach Stoffen von universeller und prinzipieller Tragweite suchte, in denen er dichtend zugleich eine Weltanschauung aussprach. Auf dieser Linie bewegen sich in dieser und der nächstfolgenden Zeit Stoffe wie Sokrates, Prometheus, Cäsar, Ahasverus, Mahomet, Faust, die alle auszutragen auch über seines Geistes Maß ging; und an dem einen Stoff, von dem er nicht abließ, trug er sein Leben lang. Und dies eben darum, weil es von allen der zugleich universellste und persönlichste war. In welchem Grade Faust gerade ein Spiegel eigener Konfessionen war, zeigt jede neue Forschung immer heller. Es wird uns unten entgegentreten, wie Goethe selbst bei seinem Übergang nach Wetzlar mitten in einer inneren Gährung und Krisis steht. Dies überreiche Ausgeben setzte ein reiches Einnehmen, und nicht bloß aus Büchern, sondern aus lebendigem Menschenverkehr voraus. Ein solcher fehlte in dem denkwürdigen Frankfurter Winter von 1771 bis 1772 nicht. Doch fand ihn der Dichter ungleich weniger in der Vaterstadt, die er überhaupt schon damals nicht mit sympathischem Blick ansah, als in der Nachbarschaft, in Darmstadt und Homburg. Hier erschloß ihm der geistig gemütliche Verkehr mit Merck und jener Dreizahl der Freundinnen Louise v. Ziegler, Fräulein v. Roussillon und Karoline Flachsland — oder in der poetischen Sprache: Lila, Urania und Psyche — eine neue Welt. Bildete sich auch zu keiner ein leidenschaftliches Verhältnis, weil dem Dichter noch die verlassene Friederike in dem Elsässer Dörfchen in Erinnerung und Gewissen zu gegenwärtig war, so streifte doch die Hinneigung zu Lila namentlich dergestalt an Liebe, daß die weiche Schwärmerin unter ihren »Lauben und Rosen und ihrem Schäfchen, das mit ihr ißt und trinkt«, selbst an eine solche glaubte und den Dichter bedauerte, daß neben einer anderen Neigung in ihr auch die unübersteigliche Mauer des Standesunterschiedes sie trennte. Es war dort die modische Empfindsamkeit in der sublimiertesten und ätherischesten Gestalt zuhause, und für den Dichter war es wie ein Resonanzboden, worin jedes poetische Erzeugnis und jede poetische Regung des Moments verständnisvollen Wiederklang fand. Und unter dieser weiblichen Dreizahl befand sich Herders Braut, die somit zum Wärmeleiter und zur Vermittlerin zwischen dem oft verstimmten Meister und dem vertrauenden Jünger wurde.
Und dieses Zaubernetz, in welchem Goethe sich nicht nur wohl, sondern selig fühlte, das er im Frühjahr 1772 wiederholt als stürmischer »Wanderer« aufsuchte, sollte nun zerrissen werden. Gleichwohl war es nicht bloß das Leidgefühl, das Goethe bewegte, als er der Vaterstadt auf Monate den Rücken kehrte. Vielmehr war es ein gemischtes Gefühl und eine Doppelstimmung. Von Frankfurt selbst, das er gelegentlich eine »Spelunke« nennt, und von der kaum begonnenen, aber von vornherein verhaßten und als Nebensache betriebenen Advokatur, aber auch von dem Vaterhaus und speziell von dem Vater selbst, dem vielfachen Beschränker seiner genialen Lebenswünsche und Gewöhnungen, trennte er sich leicht. Freilich war es gerade des Vaters juristischer Fortbildungsplan, der ihn nach Wetzlar trieb, und die väterliche Hoffnung, er werde dort tiefer in die Rechtspraxis eingeführt werden und dadurch größeren Geschmack an seinem eigentlichen Lebensberufe finden. Trat er damit doch nur in die Fußtapfen des Vaters, der in jungen Jahren gleichfalls den Reichsprozeß an dieser Quelle studiert hatte. Ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Vater zeitweise noch weitergehende Gedanken an diese Wetzlarer Digression knüpfte, den Wunsch nämlich, daß sich der Sohn vielleicht dauernd dort als Advokat oder Prokurator festsetzen würde. Es war dies wohl ein Reserveplan, wenn der ursprüngliche, sich durch die vaterstädtische Anwaltschaft zu städtischen Ämtern geschickt zu machen, scheitern sollte. War dies des Vaters Plan, so hatte der Sohn schon einen Gegenplan im Kopfe, als er gen Wetzlar zog. Stritten in Frankfurt unter des Alten Augen Themis und die Musen um seinen Besitz, so gedachte er, der väterlichen Kontrolle ledig, in Wetzlar diese Geteiltheit abzuschütteln und der Themis zeitweise Valet zu sagen.
Читать дальше