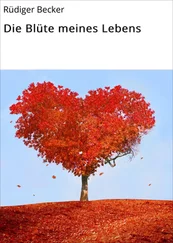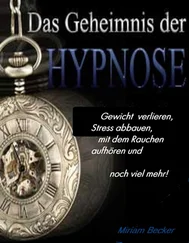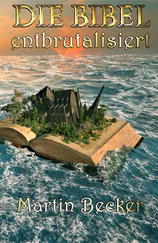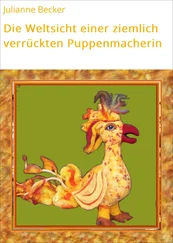„Kommen heute Abend an Ufer essen? Isch holen ab.“
Nicht direkt laut jubeln, nur interessiert gucken, dann erst antworten:
„Was gibt es denn zu essen?“
„Isch machen schön Fisch, Hühn, Lamm von Grill.“
„Auch Salat?“
„Schön ßßalladd.“
Eingehende Beratung der Crew im Flüsterton unter Berücksichtigung der Sympathiepunkte des Wirtes in Verbindung mit seinem essenstechnischen Angebot. Dann zögernd:
„Okay, gut, wir kommen essen.“
„Wann kommen?“
Eingehende Beratung der Crew unter Berücksichtigung eines ausgedehnten Anlegers, einer Runde Schwimmen, sowie eines plötzlich danach einsetzenden Schwächeanfalls. Dann zögernd:
„Acht Uhr.“
„Isch kommen.“
Und so war es. Pünktlich, man konnte die Uhr danach stellen, wurden wir abgeholt. Nach wunderbaren Mahlzeiten, bei denen ich mich jedes Mal wunderte, mit welch einfachen Mitteln derart köstliche Gerichte zubereitet wurden, brachte uns der Wirt mit seinem Bötchen wieder zurück. Die sternenklaren Nächte an Bord erschienen mir durch die hochgeistigen Getränke während des Essens noch funkelnder. Oft schlief ich, wohlig in meinen Schlafsack gemummelt, mitten im Satz ein. Tagsüber war aus zwei Gründen Action angesagt: Der erste Grund war der starke Wind, der zweite Grund war das männliche Geschlecht. Die Herren wollten nämlich unter keinen Umständen mit dem unter Seglern verpönten „Sunny Sailing“ in Verbindung gebracht werden. Sie liebten „die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde raues Gesicht“. Aber ehrlich, bis auf die eiskalten Winde liebte ich auch die etwas härteren Törns, wenn, ja wenn man als Frau nicht so oft bei starker Schräglage auf die Bordtoilette müsste.
Eines Abends gingen wir in einer romantischen Bucht vor Anker. Paul hatte uns schon viel von der dortigen Bude erzählt, denn der Besitzer spielte für seine Gäste Geige. Kaum rasselte unsere Ankerkette, näherte sich in Windeseile ein kleiner Kahn. Darin saß ein Junge, der alleine in etwa so schnell ruderte wie ein Doppelachter, weil zeitgleich mehrere Segelyachten in die Bucht einliefen. Selbstredend gingen wir auf das obligatorische Ritual ein, obwohl schon lange feststand, dass wir dem Geiger einen Besuch abstatten wollten. Wie sich herausstellte, war der Junge sein Sohn, der uns dann auch zur gewünschten Uhrzeit abholte. Im Restaurant, einer zum Meer hin offenen Holzbude mit einem beachtlichen alten Steinofen in der Mitte, an dessen Esse einige undefinierbare Raritäten hingen, hockten bereits einige Crews. Paul raunte uns zu:
„Die sind alle hier wegen Mary.“
Ich verstand nicht so recht. „Ist das die Köchin?“
Er lächelte verschmitzt und sagte nur: „Warte ab!“
Mittlerweile waren auch die Segler unserer Nachbaryacht eingetroffen. Ein australisches Paar. Schon älter, indes sehr auffällig und mit einer Lautstärke, die auf ein paar Anleger zuviel schließen ließ. Unser Gastronom begrüßte seine Gäste überschwänglich. Er sprach etwas in Englisch, das sich großzügig übersetzt anhörte wie: „Ihr seid prima Gäste, wenn ihr bitte viel bestellen zu essen, ihr können dann auch viel trinken. Wenn so ist, Musik machen, dann mit Boot zurückbringen.“ Dieser netten Aufforderung konnten wir nicht widerstehen. Als gut erzogene Rheinländer von der wahrscheinlich längsten Theke der Welt, aßen und tranken wir was das Zeug hielt. Und, wir wollten Musik! Die Stimmung stieg. Den Wirt, dessen mächtiges Kinn ein dunkler Stoppelbart zierte, beglückten wir damit außerordentlich, denn sein Lächeln wurde immer breiter und entblößte Zahnfragmente, deren Vorhandensein nur noch auf punktgenaue Nahrungsaufnahme schließen ließ. Endlich war es soweit: Er griff über den Ofen und angelte sich dort ein angekokeltes Instrument, das vielleicht früher mal eine Geige war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es für einen verbrannten, halbantiken Blasebalg gehalten. Das australische Pärchen klatschte begeistert. Enthusiastisch fielen wir mit ein. Beflügelt von soviel Applaus begann das kleine Kammerkonzert. Seine riesigen, zentimeterdick mit Hornhaut bedeckten schwarzen Füße, klatschten zunächst den Takt auf den Holzboden. Dann strich der Maestro die Saiten seiner Fidel. Ich lachte, denn es hörte sich an wie „Oh Lady Mary“. Es war Oh Lady Mary! Alle Zweifel wurden beseitigt, als er anfing dieses Lied zu singen. Wie unüberbietbar schräg, in einer idyllischen, unbewohnten Bucht der türkischen Ägäis auf einen Oh Lady Mary singenden Strandbudenbesitzer zu treffen, der sich selbst auf einer vorsintflutlichen, halbverbrannten Geige begleitet. Unsere Contenance ließ uns völlig im Stich, vor allem, weil er seine Hymne wieder und wieder anstimmte. Sein Repertoire bestand aus einem einzigen Lied: Oh Lady Mary! Jetzt wusste ich auch was der Käpt´n meinte, und ich wusste auch, warum der Laden so gerammelt voll war. Da der Teufelsgeiger unser mittlerweile hemmungsloses Gelächter als selige Anerkennung seiner Kunst deutete, gab es für unseren Tisch die meisten Zugaben. Dankbar zahlten wir gut angesäuselt irgendwann für Essen und Entertainment bei seinem Sohn, der uns zur Yacht zurückruderte. Dort angekommen, ließen wir den Abend bei diversen Absackern noch einmal Revue passieren, was eher misslang, da wir vor Lachen kaum der Sprache mächtig waren. Plötzlich sprang Klaus-Willi auf: „Die Australier sind noch da, ich glaube die tanzen.“
Paul kletterte blitzschnell unter Deck und holte das Fernglas: „Ich werd´ verrückt, die Frau tanzt mit dem Geiger!“
Ich griff nach dem Fernglas: „Lass gucken! Stimmt! Und wie die tanzen! Ach ne…und Sohnemann spielt Geige.“
Bernd nuschelte: „Vielleicht kann der es ja besser.“
Klaus-Willi griff sich das Glas: „Leute schaut euch das an! Ihr Mann liegt mit dem Kopf auf dem Tisch.
„Aufgeschlagen und ohnmächtig? Oder nur eingeschlafen“, fragte der Käpt´n.
Wir grölten. Das Fernrohr kreiste weiter, so wie das türkisch-australische Tanzpaar, dessen weiblicher Teil sich kaum auf den Beinen halten konnte. Aber sie hatte ja einen starken Partner. Beide schienen sich köstlich zu amüsieren, denn der Wind wehte das Gelächter zu uns an Bord. Und wir fielen mit ein. Völlig unerwartet sprang der vormals Bewusstlose vom Tisch auf und gab das Zeichen zum Aufbruch. Wir rissen uns um das Fernglas. „Wie will die denn so voll ins Boot kommen, und die Stufen zum Steg runter? Schafft die nie“, fachsimpelte Bernd.
„Oh, sie aber wird von drei Männern gestützt“, stellte ich fest.
„Davon ist aber zumindest einer sternhagelvoll“, kommentierte Klaus-Willi.
Der Sternhagelvolle kümmerte sich beim Einstieg um sich selbst. Er rutschte zwar gefährlich an der Kante ab, traf dann aber zielsicher die Planken des schwankenden Kahns. Es folgte der Sprössling, um der Dame die Hand zu reichen, die sie nach ihm ausstreckte. Paul war der Glückliche der zu diesem Zeitpunkt das Fernglas hatte: „Auweia, die greift immer daneben. Jetzt schiebt der Alte sie von hinten an. Neeiin, nein! Achtung- die fällt! Die fällt mitten ins Boot!“ Er prustete los: „Wie eine Bahnschranke, aber wenigstens nicht ins Wasser.“ Aber auch wir anderen konnten den pfeilgeraden Fall sehen, da sich die Silhouette des weißen Kleides ausgezeichnet gegen den dunkelblauen Nachthimmel abhob. Unser Gelächter wich allmählich regelrechten Lachkrämpfen. Ich bekam keine Luft mehr, mein Bauch tat weh und mein Gesicht war tränenüberströmt.
Oh Lady Mary!
Wir konnten nicht mehr sehen, wie die Australier an Bord ihres eigenen Schiffes gelangten, da sich unsere Boote sanft um die eigenen Ankerketten drehten. Am nächsten morgen wunderte ich mich, als ich in meinem Schlafsack aufwachte und noch die Klamotten vom Vorabend trug. Nebenbei tat mir auch der rechte Knöchel weh. Ich kletterte an Deck. Unsere Australier waren bereits weg. Ein hartes Volk, dachte ich anerkennend, da möchte ich auch mal hin. Die Jungs waren auch schon aktiv und auf meine Frage, wann ich denn in die Koje gegangen sei, schauten sich alle drei grinsend an.
Читать дальше