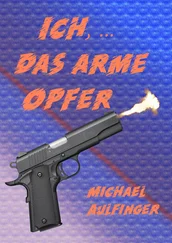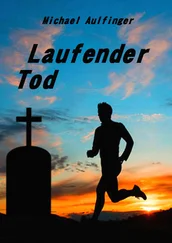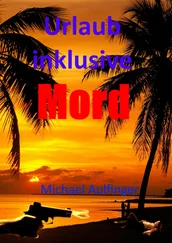Aufmerksam hörte Rudolfs Vater zu. Er war nur ein einfacher Zimmermann. Seit Generationen führte er die Familientradition fort, die sein Großvater Eckhart begonnen hatte. Der Vater hatte Sinn für lustige Geschichten, und hörte gerne zu.
Einige Tage vergingen, bis an einem trüben Tag mit Nieselregen eine Frau in das Hospital trat. Unsicher blickte sie sich um, bis sie den Gesuchten in einer Ecke fand. In ihren Augen lagen Trauer und Sorge. Trauer empfand sie wegen ihres Mannes Claus, den sie beerdigt hatte, und Sorgen um ihre Zukunft. Sie war eine arme Frau, die nicht wusste wie es weitergehen sollte. Sie war den weiten Weg aus Cletlinge gekommen, um von ihrem Sohn, den sie im Sterben wähnte, ein paar Münzen zu erben. Weinend fasste sie die Hand ihres Sohnes an.
„Mein lieber Sohn, wo quält dich denn die Krankheit?“
Da blitzte es wieder in den Augen des Dyl auf, und trotz seines kränklichen Zustandes war ihm der Schalk nicht abhanden gekommen. Er war noch bei klarem Verstand.
„Genau hier zwischen der Bettstelle und der Wand quält mich die Krankheit.“
„Ach mein lieber Sohn, sag deiner alten Mutter doch ein süßes Wort.“
„Honig, liebe Mutter. Honig ist ein süßes Wort. Bist du jetzt zufrieden?“
Ann ließ sich ihren Unmut über den Schalk ihres Sohnes nicht anmerken. Sie kannte seinen Sinn nur zu gut. Daher sprach sie von den zwischenzeitlichen Geschehnissen in Cletlinge.
„Du kannst dich sicherlich noch an den Abt Arnold Papenmeyer aus dem Aegidienkloster erinnern. Er war derjenige, der dich getauft hatte. Er ist auch schon von uns gegangen.“
„Siehst du“, scherzte Dyl. „Auch vor dem Klerus macht der Tod nicht halt. Und bald wird er mich ereilen.“
„Lieber Sohn, du hast ja viele Reisen als Wahrheitssager getan. Dann gib mir doch noch eine gute Lehre mit auf den Weg, bei der ich deiner gedenken kann.“
Dyl neigte langsam seinen Kopf zur Mutter hin und sprach belehrend wie ein Lehrer zu seinem Schüler. Dabei dämpfte er etwas die Stimme, als wenn diese Lehre so wichtig, geheimnisvoll und einzigartig sei, dass nur wenige Menschen von ihr Kunde haben sollten.
„Ich habe für meine liebe Mutter eine gute Lehre. Wenn du deine Notdurft verrichtest, so kehre am besten den Arsch von dem Winde weg. So kommt der Gestank nicht in die Nase.“
Allmählich ärgerte sich Ann über ihren Sohn. Bevor er sie aber noch mehr reizte, kam sie auf den eigentlichen Grund ihres Besuches zu sprechen.
„Lieber Dyl. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich hoffe auch, dass ich dir nicht egal bin. Jetzt wo es zu Ende geht, so solltest du dein Gut verteilen. Ich bitte dich, mir von deinem Gut zu geben.“
„Weißt du, Mutter, wahrlich liebe ich dich. Aber du weißt doch, wer nichts hat, dem soll man geben, und wer etwas hat, dem soll man etwas nehmen. Und wie es sich mit meinem Hab und Gut verhält ist folgendermaßen: Mein Gut ist verborgen, sodass niemand etwas davon weiß. Bist du vom Glück gesegnet und findest etwas, was mir gehört, so magst du es nehmen. Ich gebe dir von meiner Habe alles, was krumm und was gerade ist.“
Seine Mutter verstand den Sinn der Worte nur zu gut. Es war von ihrem Sohn nichts zu erben. Sie war den ganzen weiten Weg aus dem Braunschweigischem Land gereist, und würde nun ohne eine wohlklingende Münze wieder abreisen. Schluchzend stand sie auf und verließ das Hospital. Sie war dermaßen enttäuscht, dass sie noch am gleichen Tag nach Cletlinge zu dem Wald Melme zurückreiste.
Rudolf und Arnulf hatten an diesem sonnigen Tag im Jahre 1350 wieder Dyl besucht. Auch diesmal hatte er wieder Geschichten erzählt. Gebannt hatten die Freunde gelauscht, denn lustig waren die Geschichten allemal. Er hatte gerade ein Erlebnis erzählt, in dem er damals in Helmstedt sich auf Kosten eines Bäckers vollgegessen hatte und der Bäcker Dyl auch noch auf eigene Kosten einen kranken Zahn ziehen ließ, als eine Begine an sein Bett trat.
„Lasst uns allein.“
Diese herrischen Worte waren an die Jungen gerichtet. Unsicher, ob sie dem Befehl folgen sollten, blickten sie Dyl hilfesuchend an. Er nickte.
„Geht, meine Freunde. Doch kommt bald wieder. Dann werde ich euch weiter von meinen vielen Reisen berichten.“
Die Knaben gehorchten und gingen aus dem Hospital. Sogleich setzte sich die Begine Adelheid auf seinen Bettrand. Sie hatte ein ernstes Gesicht aufgesetzt.
„Ich muss mit euch sprechen. Ihr wisst selber zu genau, dass eure Tage auf Erden gezählt sind. Damit ihr vor den Herrn treten könnt, ist es nötig, dass ihr das Abendmahl empfangt. Doch zuvor müsst ihr allerdings Reue und Leid wegen eurer Sünden empfinden. Dann könnt ihr auch zufrieden und süß sterben.“
Dyl schüttelte den Kopf.
„Da irrt ihr euch. Mein Sterben wird nicht süß sein, denn der Tod an sich ist bitter. Und warum soll ich heimlich beichten? Was ich in meinem Leben getan habe, das ist vielen Leuten in vielen Landen nur allzu gut bekannt. Wem ich Gutes tat, der wird auch gut über mich sprechen. Andersherum genauso. Wem ich Böses tat, der wird dies trotz meiner Reue verkünden. Also sei’s drum. Aber trotzdem will ich euch wissen lassen, dass ich drei Dinge unterlassen habe, und nicht tun konnte. Und dies ist das Einzige, was ich zutiefst bereue.“
Die Begine richtete ihren Oberkörper auf. Sie glaubte, den Todkranken zu ehrlicher Reue gebracht zu haben. Ein gewisser Stolz erhob sie innerlich, dass gerade sie es sein sollte, der er seine Reue zeigen würde.
„So sprecht doch. Was sind das für Dinge, die ihr unterlassen habt? Waren es gute oder böse?“ Ein wenig drängelte sie ihn zu seiner Reue. Dyl dagegen ließ sich nicht drängeln. Er lag auf dem Rücken, den Blick auf die schäbige Decke gerichtet, und sprach ruhig und langsam mit einem ernsthaften Ton.
„Wie ich schon sagte, waren es drei Dinge. Wie gerne würde ich das Versäumte nachholen. Wenn ich zum Einen in meinen jungen Jahren sah, dass ein Mann auf der Straße ging, dem der Rock lang unter dem Mantel heraushing. Dies ärgert mich noch bis heute, dass ich es unterlassen habe das heraushängende Stück abzuschneiden.
Des Weiteren sah ich einen Mann, wie er sitzend mit einem Messer zwischen seinen Zähnen stocherte. Oh, wie gern hätte ich ihm die Arbeit abgenommen und ihm das Messer vollends in seinen Hals gestoßen. Denn ein Messer ist – wie jeder weiß – eine tödliche Waffe, und nur jemand, der des Lebens müde ist und es beenden will, fuchtelt damit in seinem Mund herum. Wie gern hätte ich also dabei geholfen, sein Leben zu beenden. Dies bereue ich bis heute, nicht getan zu haben. Wie gern würde ich die Zeit zurückdrehen.“
Dyl seufzte hörbar und blickte weiter sehnsüchtig an die Decke.
Die Begine glaubte sich verhört zu haben. Redete der kranke Mann wirr? Vernebelte die Krankheit seinen Verstand? Erschrocken hörte sie Dyl von seiner dritten Reue berichten.
„Als Letztes bereue ich, nicht allen alten Frauen ihre Hintern zugenäht zu haben. Denn diese alten Weiber sind zu nichts mehr nütze, als das sie nur noch das Erdreich bescheißen, auf dem die Frucht steht.“
Die Augen der Begine verengten sich zu schmalen Schlitzen. Ihre Körperhaltung nahm die gleiche Stellung ein, wie sie eine Raubkatze kurz vor dem Sprung auf ein Opfertier einnimmt, welches es zu reißen gilt.
„Ihr sprecht wirr.“ Sie bemühte sich ruhig zu bleiben, doch fiel es ihr sichtlich schwer, ihn nicht empört zurechtzuweisen. „Das hieße gar, das auch ihr mir den Hintern zunähen würdet, wenn ihr gesund wäret, da ich schon über sechzig Jahre zähle.“
Dyls Augen blitzten trotz seines schlechten Zustandes auf. Er drehte seinen Kopf zu der erregten Beginne, und sprach im ruhigem Ton:
„Es tut mir wahrlich leid, dass es bisher noch nicht geschehen ist, aber in eurem Fall kann Abhilfe geschaffen werden. Ein paar Stiche mit der Nadel bekomme ich sicherlich noch hin. Wenn ihr also Nadel und Faden holen, und euer Hinterteil entblößen würdet, wäre ich euch recht dankbar. Dann könnte ich wenigstens ein Versäumtes in meinem Leben nachholen. So wäre mir das Sterben wirklich leichter.“
Читать дальше