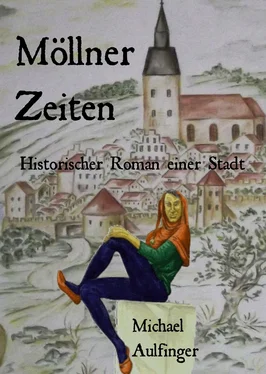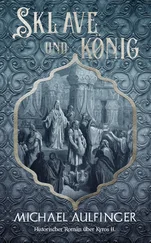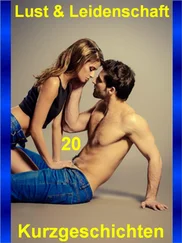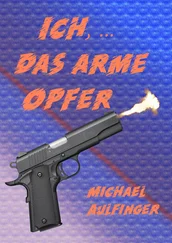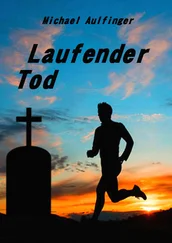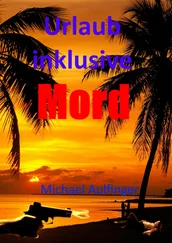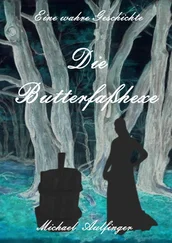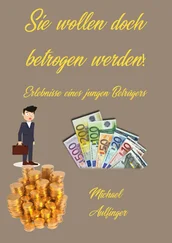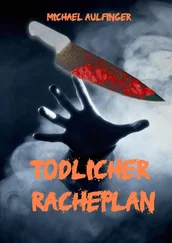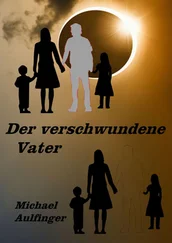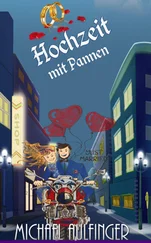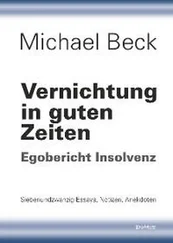In dieser Urkunde verpflichteten sich nämlich Herzog Albrecht IV. und Elisabeth, innerhalb der Stadt keine Zwingburg oder jegliche sonstige Form eines castrums zu erbauen.
Der Rat wollte nämlich keine neue Burg innerhalb oder außerhalb der Stadt haben, von der sie beherrscht werden würde. Dies galt es zu verhindern. Hermann Dusekop war vor acht Jahren als Ratsherr selber dabei gewesen, als Gerhard vor den Toren der Stadt seine werborch erbaut und die Macht besessen hatte, dem Rat seine Bedingungen zu diktieren. Dies war dem Rat ein warnender Hinweis gewesen, ein derartiges Bauwerk für die Zukunft zu verhindern. Vor dem Steintor befanden sich immer noch Reste der werborch . Nach all den Jahren war es noch nicht gelungen, alle Spuren davon zu tilgen. Den Bürgern und dem Rat der Stadt war es daher wichtig gewesen, nie wieder in ihrer Nähe eine Zwingburg zu wissen. Sie fürchteten sich davor.
Obwohl die Belagerung und die Streitigkeiten mit der herzoglichen Familie jetzt schon acht Jahre zurücklagen und der damalige Vertrag auch eingehalten worden war, hatte all die Jahre der Konflikt weiter geschwelt. Erst jetzt galt es, sich durch einen neuen Vertrag zu versöhnen. Der Herzog und seine Mutter, die immer noch aktiv an den Regierungsgeschäften beteiligt war, mussten auf eine gewaltsame Beherrschung der Stadt verzichten. Dazu waren sie gezwungen worden. Zu gerne hätten sie von einer Zwingburg in der Stadt aus diese rebellischen Bürger beherrscht. Sie bestätigten erneut die lübschen Rechte der Stadt. Der Rat gelobte dafür, ihren herzoglichen Herren allzeit gehorsam zu sein, wie es Brauch war.
Dusekop konnte sich seiner Zufriedenheit nur schwer entziehen. Für ihn war diese Urkunde ein Friedensvertrag zum Vorteil der Stadt. Eigentlich wurde darin nur der alte Zustand bestätigt. Dusekop reichte die Urkunde an Gottfried de Krempe weiter. Als dieser nach der Lesung nickte, reichte Gottfried die Urkunde dem jungen Herzog zurück.
„Mein Herzog, es ist zu unserer Zufriedenheit. Wir hoffen, dass wir Euch unsere Dankbarkeit als treue Untertanen noch oft beweisen können.“
„Das hoffe ich auch.“
Albrecht war der leicht hochnäsige Ton des Bürgermeisters nicht entgangen. Doch tat er so, als habe er ihn überhört. Dann siegelte er im Beisein von Zeugen die Urkunde.
Ein Jahr darauf litt der Herzog erneut unter der adeligen Krankheit der Geldarmut. Als ob es keinerlei Alternative geben würde, so führte sein Weg ihn wieder nach Holstein. Jedoch war dieses Mal die Summe höher, die er sich von seinem Onkel lieh. Es ging um die Summe von 10000 Mark Silber. Aber diesmal war das Geld nicht dafür gedacht, Löcher in seiner Kasse zu stopfen, um den Hofstaat aufrechtzuerhalten. Das Geld wurde nämlich mit seiner Mutter Elisabeth als Mitgift nach Dänemark gebracht. Herzogin Elisabeth heiratete in ihrer zweiten Ehe Erich, einen Sohn Christophs von Dänemark. Durch die Hochzeit versuchte ihr Bruder Gerhard, mehr Einfluss am dänischen Hof zu erlangen. Die Verpfändung selbst umfasste wieder die Stadt Molne , die Vogtei Molne, die Vierlande und den Sachsenwald.
Somit verschwand die ehrgeizige Herzogin Elisabeth aus dem Herzogtum Sachsen-Lauenburg. Albrecht war darüber nicht unglücklich. Endlich konnte er trotz seiner jungen Jahre so leben, wie er es für richtig hielt. Seine Mutter hatte ihn stets bevormundet. Jetzt war er froh darüber, die Regierungsgeschäfte alleine bewältigen zu können.
Viel Arbeit wartete auf ihn. Der junge Herzog war nicht mit Dummheit geschlagen. Mit Herz und Verstand meisterte er die ihm gestellten Aufgaben. Auch der Salzhandel verlangte ihm Entscheidungen ab. In einer Urkunde vom 07. September 1342 verfügte der Herzog, Wan also vell soltes is to Molne, dat men schepen mag 24 pramen, eder 30, und dar enttwischen degene kemen, de dat solt begehret und dat water eschet von deme de de schlusse bewahret, des negesten dages darna schal man dat water geven, also dat se to Lubecke mögen kamen to allen tiden von Paschen went to unser Frowen dage der ersten.
So wurde verfügt, dass dann, wenn soviel Salz in der Stadt gelagert wurde, dass es auf 24 bis 30 Prähme verladen werden könnte, und falls Käufer hierfür vorhanden waren, und das Wasser vom Schleusenwärter gefordert wurde, am nächsten Tage dem aufgestauten Wasser freien Lauf gelassen werden sollte. Dies sollte aber nur in der Zeit zwischen Ostern und dem 15. August geschehen. Es gab auch Stecknitzfahrer aus Molne und nicht nur aus Lubecke oder Lauenburg. Einige Bürger der Stadt hatten nicht nur die Prähme erbaut und waren am Transport beteiligt, sondern einige besaßen sogar Salinenanteile. Der Salzhandel brachte so den Reichtum in die Stadt.
Der fremde Mann
1350
Die Sonne stand schon tief und würde in einer Stunde am westlichen Rand des Sees die Baumkronen berühren. Rudolf warf trotzdem noch seine Angelschnur in den Wassergraben neben dem Steintor aus. Er war nicht alleine. Neben ihm saß sein bester Freund Arnulf. Auch er hielt seine Angel gelangweilt in das Wasser. Bisher hatte noch kein Fisch angebissen. Vielleicht lag es am Köder? Sie hatten Regenwürmer am Ufer des Molner Sees ausgegraben. Aber noch wollten beide nicht aufgeben. Einmal – es mochten schon viele Wochen her sein – da hatten beide Jungen die grätenreichen Brassen an dieser Stelle geangelt. Schweigsam saßen die Freunde nebeneinander und starrten auf den Stadtgraben hinab.
Da hörte Rudolf, wie eine von einem alten Gaul gezogene Karre neben ihm, aber noch vor der Brücke, anhielt. Das war nichts Ungewöhnliches, denn ständig verkehrten hier Fuhrwerke und brachten Waren in die Stadt oder aus ihr heraus. Die Karre quietschte und klapperte auf dem unebenem Boden wie jede gewöhnliche Karre eines Händlers oder Bauern.
Aber diese Karre hatte eine andere Ladung als Salz, Getreide oder Tücher. Ein älterer Mann entstieg ihr. Er trug eine kunstvoll verzierte Kiste, die aber äußerst schwer wirkte, denn er mühte sich ab, sie von der Karre zu heben. Polternd und Staub aufwirbelnd glitt sie kurz vor seinen Füßen zu Boden. Stöhnend richtete er sich aus seiner gebückten Haltung auf und fasste sich, begleitet von einem schmerzverzerrten Gesicht und einem herausgekrächzten „Arrrghh“, an den Rücken. Der Bauer trieb seinen Ochsen derweil an, und der Karren fuhr weiter.
Dann winkte er überraschend Rudolf und Arnulf zu, die beide den Vorgang aufmerksam verfolgten. Neugierig folgten sie dem Wink und legten vorher ihre Angeln ab.
„Gottes Gruß.“ Artig begrüßten sie den Fremden mit der üblichen Ansprache.
„Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn gerne von Euch grüßen.“
Üblicherweise war es Sitte, auf den Gruß mit Gottes Dank zu antworten. Angesichts der ungewohnten schelmenhaften Art der Grußerwiderung sahen sich die Freude jedoch verdutzt an. Rudolf fand als Erster die Worte wieder.
„Fremder Herr, was ist euer Anliegen? Ihr habt uns zu euch gewinkt. Womit können wir euch dienen?“
„Ihr seid ja zwei kräftige Knaben. Da seid ihr genau die richtigen Träger für mich. Wollt ihr meine Kiste tragen?“
Die Freunde sahen sich kurz an, nickten und wandten sich wieder dem Fremden zu.
„Aber natürlich. Nur, Herr, müsst ihr uns sagen, wo wir sie hintragen sollen.“
„Das werde ich, doch zuerst müsst ihr mir sagen, in welcher Herberge gut zu nächtigen ist. Außerdem muss ich noch zu einem Apothekermeister. Könnt ihr mir auch dabei einen empfehlen?“
Arnulfs Augen blitzen auf.
„Oh ja, zufällig befindet sich am Marktplatz eine Herberge, die auch einem Apotheker gehört. Seine Stube mit den Arzneien und Kräutern ist im gleichen Haus. So habt ihr beides unter einem Dach.“
Читать дальше