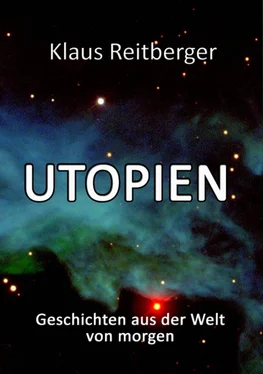Und doch ist nicht alles perfekt, wie Christian Vidocq eben berichtet. Samantha hört ihm nur halb zu. Sie hat die vielen Berichte über die steigenden Selbstmordraten satt und hegt eine tiefe Verachtung gegenüber all jenen, die diesen Weg beschreiten. Wo liegen die Gründe für die Mutlosigkeit vieler? Geht die Entwicklung zu schnell voran? Für Samantha geht sie nicht schnell genug. Irgendwo in Asien gibt es immer noch Orte, wo alte, dumme Maschinen von Menschen gesteuert wurden. In den Anden verstecken sich Rebellen, die einen alternativen Lebensstil praktizieren. Dies sind die wahren Probleme. Jene, die für die Zukunft nicht reif sind, sollen ruhig aus dieser Welt scheiden.
Samantha äußert ihre Meinung nicht laut, da sie weiß, dass sie damit auf Widerstand stoßen wird. Nach einigen fruchtlosen Diskussionen endet die Konferenz und man vertagt sich. Aber wozu? Im Grunde sind auch diese Zusammenkünfte fast schon zwecklos geworden. Der Ball rollt bereits und er wird immer weiter rollen. Man muss ihn nicht mehr anstoßen. Das Uhrwerk ist fertig und tickt unentwegt. Es muss nicht gewartet und neu aufgezogen werden. Auch das geht von selbst. Samantha ahnt es. Bald werden auch diese Konferenzen ihr Ende finden und die letzten arbeitenden Menschen werden sich zurückziehen. Eines Tages wird man den Maschinen alles übergeben, denn sie machen ihre Sache gut. Die Aufgaben sind klar definiert: dem Menschen ein möglichst schönes Leben schaffen und seine Wünsche erfüllen. Was will man mehr?
Als Samantha etwas später wieder in einer Transporteinheit sitzt, lässt sie das Fahrzeug auf dem Heimweg bei der Grünbaumgasse vorbeifahren. Etwa zwanzig Menschen sieht sie dort stehen. Einer nach dem anderen verschwindet. In Unverständnis schüttelt Samantha den Kopf. Gerne hätte sie sich einen der Unglücklichen in den Wagen geholt und ihn ausgefragt, warum er hier ist, doch irgendetwas lässt sie vor diesem Schritt zurückschrecken. Rasch weist sie dem Vehikel an, sie nach Hause zu bringen.
III
Li ist verzweifelt. Er sitzt bei sich zu Hause und starrt eine Wand an. Schon wieder ist ein Tag vergangen, doch morgen wird er ihn vergessen haben. Es sind ja doch alle Tage gleich und das Führen von Tagebüchern verlor schon lange jeden Sinn. Man kann nicht einfach so durchs Leben gehen ohne dafür zu kämpfen, dass man leben kann. Man braucht etwas zu tun. Viele Menschen malen, viele dichten heutzutage. Doch es sind zu viele. Da es sonst nichts mehr gibt, wollen sie nun alle Poeten sein, wollen alle die Muse küssen. Das Ergebnis ist, dass die Kunst verkommt, da es zu viele Künstler gibt. Menschen, die in früheren Zeiten nie Feder oder Pinsel in die Hand genommen hätten, tun dies nun. Manche schaffen wahrlich Wunderbares, doch in der Sturmflut von neuen Werken, größtenteils Belangloses, sind diese Funkelsteine nicht zu sehen. Welch Unsinn doch jeden Tag geschrieben wird. Schon längst ist die Lust zu lesen Li vergangen, zumindest die Lust neue Bücher zu lesen. Gern verliert er sich in der Geschichte und den alten Werken, doch irgendwann kommt stets der Zeitpunkt, an dem er ein Buch weglegen muss, da er es nicht mehr erträgt weiter zu lesen. Er wünscht sich nichts sehnlicher als in die Vergangenheit zu reisen. Viel reicher und froher erscheint ihm doch das Gestern im Gegensatz zum Heute.
Sein Lampenschirm fragt ihn, was er zum Abendessen wünscht. Li ist ratlos. Vorschläge fordert er. Diese kommen. Schließlich wählt er Butterbrote. Schmeckt ja doch alles gleich. Bald darauf steht das Essen auf dem Tisch. Unwillig blickt Li auf die Brote herab. Wenn er sagen könnte, er habe sie sich verdient, dann wäre dies schon etwas Neues, dann hätte er vielleicht sogar Appetit. Doch verdient hat Li nichts. Weder die Butterbrote, noch seine Wohnung, noch das Recht am Leben zu bleiben. Er hat überhaupt nichts verdient. Niemand hier hat etwas verdient.
„Dennoch haben wir alles und leiden darunter“, murmelt Li halblaut vor sich hin.
Er lässt die Brote stehen und tritt an die leere Wand, welche er schon seit Stunden fast ununterbrochen anstarrt. Er bittet um die Bilder seiner Ahnen und sie erscheinen vor ihm. Da sind sie, die Alten. Doch es gibt auch Aufnahmen aus ihrer Jugend. Die ältesten Bilder sind sogar noch zweidimensional. Nicht viele haben zweidimensionale Bilder ihrer Vorfahren. Ihre Namen stehen darunter. Daneben Geburts- und Sterbejahr. Auch der Beruf ist dort zu lesen. Li überfliegt die altbekannten Daten mit den Augen. Jonathan Henzel - Maurer. Dieser ist im letzten Krieg aufgewachsen. Krieg muss eine seltsame Sache gewesen sein. Und Maurer ist er gewesen. Maurer. Jakob weiß nicht, was das ist, doch es klingt beeindruckend. Maurer. Das klingt nach Kraft, nach selbst erarbeitetem Brot im Schweiße seines Angesichts. Es muss schön gewesen sein ein Maurer zu sein. Und ungesund. Nur 64 Jahre alt ist Jonathan geworden. Miranda Fried – Chirurgin. Diese war Lis Ururgroßmutter, wenn er nicht irrt. Eine Chirurgin. Das ist schwer vorstellbar für Li. Menschen, die trotz all ihrer Fehleranfälligkeit an anderen Menschen herumbasteln. Auch Fahrzeuge wurden damals von Menschen gelenkt. Li findet es immer wieder erstaunlich, dass andere tatsächlich so viel Vertrauen hatten, sich in ein Fahrzeug zu setzen, das von Menschenhand gesteuert wurde. Es muss Unfälle gegeben haben, damals. Viele Unfälle. Miranda Fried starb bei einem Flugzeugabsturz. Wurden Flugzeuge damals etwa auch von Menschen gesteuert? Wohl ja. Sonst hätte es kaum Unfälle gegeben. Welch Wahnsinn! Mutige Vergangenheit.
Ein anderer Vorfahre: Herbert Fried. Ein Lehrer. Was das war, weiß Li. Er hat es einst gelernt. Nicht von einem Lehrer, versteht sich, denn die gibt es ja schon lange nicht mehr. Die letzten zweiundvierzig Jahre seines Lebens hat dieser Lehrer in Rente gelebt. Etwa so wie Li sein ganzes Leben lebt. Doch Herbert hat sich dies verdient. Li nicht. Noch einer. Theodor (Ted) Grün - sein Großvater, ein Techniker. Dieser hat schon die Anfänge der Langeweile gesehen. Auf den älteren Bildern, auf denen er ergraut ist, sieht er stets so traurig aus. Nicht so auf den jüngeren. Seltsam war die Kleidung des vergangenen Jahrhunderts. Bis auf diese ähnelt Li seinem Großvater sehr. Nur die Augen sind anders und besonders deren Ausdruck. Li hat nie so fröhlich in die Welt geblickt.
Wie sagte seine Freundin Mia heute Mittag? „Es geht uns besser als allen anderen Menschen, die es je gegeben hat.“
„Geht es uns wirklich besser?“, denkt Li.
Man lebt länger. Man ist gesünder, man hungert nicht, man friert nicht. Niemand quält einen. Kein Krieg. Man ist frei. Es muss den Menschen wirklich besser gehen. Doch warum scheinen die Gesichter auf den alten Fotos dann immer so froh, so glücklich zu sein? Was hatten sie Grund zu lachen, zu lächeln, zu schmunzeln, zu grinsen, zu strahlen, wo es ihnen doch so viel schlechter ging, als ihm, Li Grün, hier und heute?
Die Butterbrote verschwinden wieder. Genug von den Geistern. Manchmal sieht Li die Alten gern – wie sie lebten, wer sie waren. Wer ist er? Einer von vielen ohne Besonderheiten. Sein Lampenschirm fragt, ob er etwas zu trinken wünscht. Er bestellt ein hochprozentiges Getränk und leert das Glas in einem Zug. Seine Kehle brennt. Das leere Glas verschwindet wieder.
Li würde gerne Menschen sehen. Er spielt mit dem Gedanken außer Haus und in die Nachtviertel zu gehen, wo viele Leute tanzend in den Straßen lachen. Doch ihr Lachen ist hohl. Wie sein eigenes, wenn er lachen würde. Hohl und nicht von Dauer. Öd und grau. Er will sich ins Vergnügen stürzen, doch der Sprung gelingt ihm nicht. Zu oft schon hat er sich auf diese Art vergnügt. So oft, dass es längst kein Vergnügen mehr ist. Denn wenn auch das Vergnügen zur Routine wird, dann ist Vergnügen kein Vergnügen mehr. Alles ist Routine. Nichts geschieht. Nichts verändert sich. Man wartet einfach nur, dass man altert und stirbt. Doch wieso warten?
Читать дальше