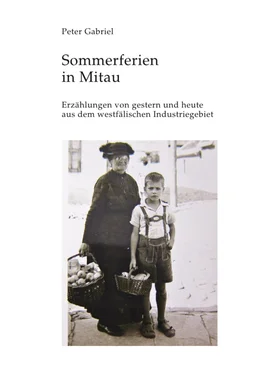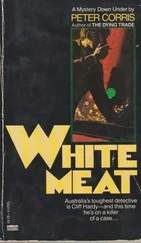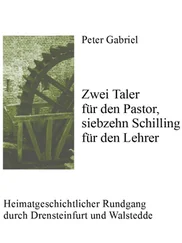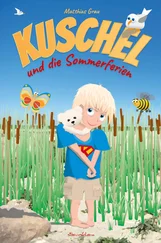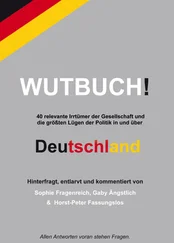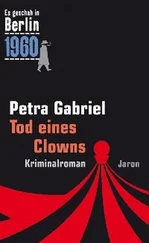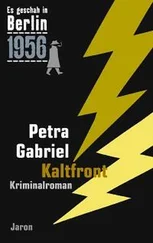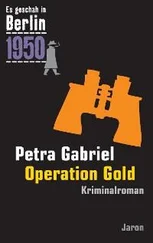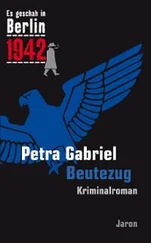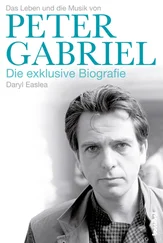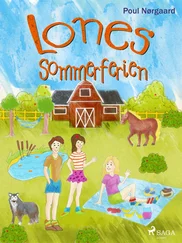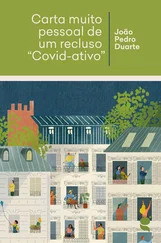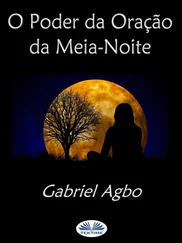Der von den Bergschülern seiner Strenge wegen gefürchtete Ingenieur Herbst behandelte in Mathematik: Ebene Trigonometrie, Stereometrie, Arithmetik und Algebra bis zu den Gleichungen zweiten Grades mit mehreren Unbekannten. Broockmann machte in der Chemie mit den wichtigsten Elementen und deren technisch bedeutsamsten Verbindungen bekannt. Er war Junggeselle, allgemein beliebt, konnte aber sehr ironisch sein. Die Fachwelt schätzte seine Arbeiten über Grubengas.
Im Hof der Bergschule diente ein zwanzig Meter tiefer Brunnen als Taucherschacht. Hier lernten die Schüler, die Pumpen zu bedienen, den Taucheranzug anzulegen und unter Wasser zu arbeiten. Die Tauchergruppe der Klasse D, zu der mein Großvater gehörte, bestand aus sieben jungen Männern, ein Tauchmeister leitete die Ausbildung.
Anfang August bekamen die Bergschüler Sommerferien, Mitte September fing der Schulbetrieb wieder an. Im letzten Jahr des Schulbesuchs war der Großvater Fahrhauer und verrichtete bereits Steigerdienste. Am 15. August 1895 fand die mündliche Prüfung statt, mein Großvater erhielt das Abschlusszeugnis mit der Gesamtnote «ziemlich gut». Die Prüfungskommission bescheinigte dem 26-jährigen, Betragen und Fleiß seien gut, der Schulbesuch sehr regelmäßig gewesen. Er hatte nun die Befähigung zum Maschinen- und Grubensteiger, konnte in der Hierarchie der Bergbaubeamten aufsteigen, allerdings nicht Obersteiger oder Betriebsführer werden. Dazu hätte es eines weiteren einjährigen Lehrgangs an der Bergschule bedurft. Die Herren des Lehrerkollegiums, der Kommissar des Königlichen Oberbergamtes und der Vorstand der Westfälischen Berggewerkschaftskasse bestätigten mit ihrer Unterschrift auch erfolgreiche Übungen im Tauchen und die Teilnahme am Unterricht in erster Hilfe bei Unglücksfällen.
Am 20. August 1895 begann mein Großvater als Hilfssteiger auf der Zeche vereinigte Dahlhauser Tiefbau, hier bewarb er sich im nächsten Jahr erfolgreich um eine Steigerstelle. Sein Gehalt, das in Goldstücken ausgezahlt wurde, betrug 120 Reichsmark im Monat, abzüglich des Knappschaftsbeitrages in Höhe von 5,2 Reichsmark. An Sonderleistungen gewährte die Zeche freien Brand (Kohle) und Dienstwohnung, im Werte von jährlich 50 bzw. 180 Reichsmark.
Im Frühjahr 1895 hatten der Großvater und die Höntroper Bergmannstochter Christine Hohoff bei dem Uhrmacher Blumenkemper in Bochum Verlobungsringe bestellt. Der Uhrmacher schickte sie per Nachnahme von acht Reichsmark zu und vermerkte auf der Rechnung: «Hoffentlich werden sie passen und zu Ihrer vollen Zufriedenheit sein. Mögen diese Ringe Ihnen beiderseits viel Glück und Segen bringen.»
Das Glück des Bergmanns blieb meinem Großvater bis 1917 treu, dann wurde er als 48-Jähriger bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte.
Der Stolz meiner Großmutter Christine war ihre Küche. Die Einrichtung bestand aus einem Schrank, einer Anrichte, einem Tisch und vier Stühlen, einem Küppersbuschherd, der mit Steinkohle geheizt wurde und einer Konsole, auf der die «Paradetöpfe» standen. Sie standen nur da, wurden nie zum Kochen benutzt, aber regelmäßig einmal in der Woche mit Sidol eingerieben und blankgewienert. Im Laufe der Zeit hatte das Aluminium einen Glanz angenommen, der überirdischer Herkunft zu sein schien; ein geheimnisvolles, inwendiges Leuchten erfüllte den Raum. Elfenbeinfarbig waren die Küchenmöbel, strahlend weiß das Spülbecken, silbergrau die Herdplatte und bunt wie ein Orientteppich der mit Balatum ausgelegte Fußboden. Kaum anzufassen wagten wir Kinder die Türklinken; nach dem Putzen pflegte meine Großmutter sie mit alten Lappen oder Strümpfen zu umwickeln, damit nicht gleich wieder ein hässlicher Fingerabdruck auf dem Messing zu sehen war.
Besonders morgens, wenn das Sonnenlicht durch die Scheibengardinen in die Küche schien, der Kanarienvogel Hansi aus voller Kehle sang und sich der Pfeifkessel Mühe gab, ihn noch zu übertönen, herrschte eine wunderbare Stimmung in der Küche. Es roch nach verbranntem Holz, unter den Eisenringen knisterte das Feuer und warf seinen rötlichen Schein an die Decke. Im Winter spendete der Küchenherd den ganzen Tag über eine behagliche Wärme. Damit sie erhalten blieb, mussten ab und zu ein paar Schaufeln Kohle nachgefüllt und die Glut gestocht werden, wobei ein Funkenregen in den Aschenkasten fiel. Meine Schwester und ich liebten es, auf dem Stuhl sitzend, die Füße in den Backofen zu stellen, was Großmutter aber nicht gerne sah, da beim Hin- und Herwippen die scharfen Kanten der Stuhlbeine Spuren im Balatum hinterließen.
Ein großer Teil des Familienlebens spielte sich in der Küche ab. Hier wurde gekocht, gegessen, gebacken, eingeweckt, bügelte Großmutter, strickte Strümpfe, ondulierte ihr Haar mit einer Brennschere, las Großvater die Zeitung, schabte sich mit dem Rasiermesser die Bartstoppeln ab. Spiegel, Seife, Seifenschale und Pinsel standen griffbereit auf der Fensterbank über dem Spülbecken. – Zu den Besonderheiten der Küche gehörte ein Hörrohr, das in die Wand neben dem Herd eingelassen war und bis ins Kellergeschoss reichte; es ermöglichte die Verständigung zwischen den Etagen. Im Keller lagen zwei Räume, deren Fenster durch Eisengitter vor Dieben gesichert waren; in dem einen lagerten Vorräte, in dem anderen stand Großmutters Wäschemangel, ein Gestell aus Gusseisen mit Kurbel und zwei hölzernen Rollen, zwischen denen die Wäschestücke geglättet wurden.
Durch die vergitterten Kellerfenster sah man in den weiträumigen Hof, der von mehrstöckigen Häusern mit Balkons umgeben war. Im Sommer blühten hier Rosen, Flieder und Goldregen, Bäume gaben Schatten; windgeschützt an der Hauswand stand eine weißlackierte Bank, die meine Großeltern beim Einzug gestiftet hatten. 1926 waren sie Mitglied der gemeinnützigen Baugesellschaft geworden; in den Häusern gab es Vierzimmerwohnungen mit gekacheltem Bad und WC , damals keine Selbstverständlichkeit. Großmutter war Anhängerin der Kneippschen Naturheilkunde, zum morgendlichen Wasch-Ritual gehörten Sitzbäder, Wassertreten und Wassergüsse; durch die Badezimmertür war das Plantschen deutlich zu hören.
Gleich neben der Küche lag ein Balkon, auf der Brüstung standen grün lackierte Holzkästen, im Sommer waren sie mit Geranien oder bunten Pelargonien bepflanzt. Auf dem Zieharmonikabett lag mein Großvater oft, wenn wir zu Besuch kamen, sein leise rasselnder Atem verriet, dass ihm die verstopften Bronchien wieder zu schaffen machten. 1917 hatte er einen schweren Unfall in der Grube gehabt, sich das Rückgrat verletzt und seinen Beruf als Steiger nicht mehr ausüben können. – Von der Straße hörte man den Lumpensammler vorbeifahren, unermüdlich blies er auf seiner Flöte; Deputatkohle wurde gebracht; der Milchbauer bimmelte, der Kartoffelhändler verkaufte «Erdäpfel», er zog das Wort inbrünstig tremolierend in die Länge und betonte die letzte Silbe. Wenn er zwischendurch Luft holen musste, betätigte sich Hansi lauthals als Pausenfüller.
In den Herbstferien 1936 waren meine Schwester und ich ein paar Tage bei den Großeltern zu Besuch. Versehentlich stieß ich eines Tages an die Konsole mit den Paradetöpfen; unter großem Lärm polterten sie über den Küchenfußboden. Ich stand erschrocken da und starrte auf das Chaos, das ich angerichtet hatte. «Halb so schlimm!» sagte meine Großmutter nur, angelte die Töpfe mit dem Besenstiel unter den Schränken hervor und stellte sie der Größe nach wieder auf die Konsole. Dort blieben sie stehen, überlebten im Dritten Reich die Altmaterialsammlungen der Schul- und Hitlerjugend; die Töpfe standen noch da, als mein Großvater 1942 während eines nächtlichen Bombenangriffs starb, und die Wohnung nach Kriegsende von der englischen Besatzungsmacht beschlagnahmt wurde. Als die Tommys endlich wieder abzogen, hatten die Paradetöpfe ihren überirdischen Glanz verloren und waren nur noch gewöhnliche Kochtöpfe.
Читать дальше