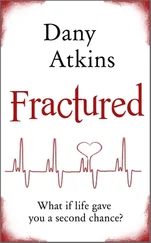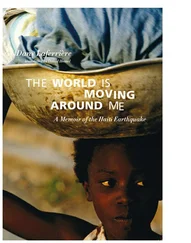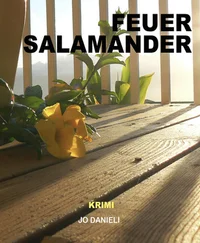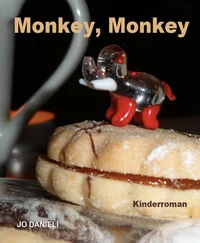Meistens besorgte Bert nachmittags das Weißbrot für das Frühstück. Keineswegs bekamen wir immer Gelegenheit, selbst noch etwas zuzukaufen, denn es gibt in den afrikanischen Ländern Straßenhändler, die nichts als Holzladen voll Weißbrot aufstellen. Und einen Spaziergang zum Dorfmarkt zu unternehmen erlaubte Bert nur selten – wir mussten schließlich kilometermachen, denn vor uns lagen Etappen voller vorhersehbarer Verzögerungen. Wir ausgehungerten Reisenden sahen verachtungsvoll über Silvias vernünftige Mahnung hinweg, das Brot doch nicht schon jetzt aufzuessen, dann würde es morgens für jene nichts zum Frühstück geben und danach erst wieder etwas am darauffolgenden Abend. Natürlich ging nicht immer derjenige beim Frühstück leer aus, der abends sein Brot vorzeitig aufgegessen hatte, neuer Konfliktstoff häufte sich im Gruppenleben ... Fand sich morgens dann tatsächlich kein Gebäck mehr, wurde letztendlich doch Müsli angerührt. Bert vermochte sich in diesen Fällen dem Murren nicht zu verschließen, hungerte er schließlich selbst. Später sollten wir, des Breies längst überdrüssig, die Haferflocken-, Getreide- und Milchpulversäcke frühmorgens gar nicht mehr ansehen mögen.
Ich habe seit jener Zeit nie wieder Milchpulver verwendet, und schon gar nicht mag ich Müsli zum Frühstück! Ein spärlicher Rosinenvorrat vermochte den Brei nur kärglich anzureichern, und wir begannen Bananen, welcher Sorte, Größe, Farbe und Art auch immer, zur Bereicherung unseres Speisezettels wie Heiligtümer zu verehren. Aber mit den Bananen verhielt es sich wie mit dem Brot: Die wenigsten Gruppenteilnehmer waren fähig, ihren Anteil sinnvoll zu rationieren. Wer sich an unbekannte exotische Früchte wagte, die auf den Märkten feilgeboten oder unterwegs von Bäumen gepflückt wurden, hatte es besser, wenn auch gefährlicher. Aber woher die Magenverstimmungen und Diarrhöeanfälle kamen, sollte nach den ersten Reisewochen bald niemand mehr zu ergründen trachten.
»In der Not frisst der Teufel Fliegen,« witzelte Karli im Zuge einer unserer ersten Lagerrunden in der Wüste, »... aber wo sollen wir die hier finden?« Weißbrot war beileibe nicht überall aufzutreiben, und zunächst vergaß auch ich, dass ich Müsli vor Antritt dieser Reise eigentlich nicht dem Essbaren zugerechnet hatte noch mir jemals vorstellen hatte können, den Tag mit löffelweise Milchpulver in simplem, warmen Wasser zu beginnen, gefärbt von ein paar Krümel Nescafé oder Teelauge. Noch war es nicht sonderlich tragisch, tageweise wenig einkaufen zu können, das nächste Dorf mit üppigem Lebensmittelangebot auf dem Markt kam bestimmt.
Wir begannen allzu früh, unsere finanziellen Reserven, die zum Kauf von Souvenirs oder Notwendigkeiten wie Zahnpasta, Seife und Waschpulver vorsorglich vom Reisebudget abgezweigt worden waren, anzugreifen, um tagsüber nicht allzu sehr darben zu müssen. Bert betrachtete die Tour offenbar als private Abmagerungskur, und fröhlich registrierte er die kontinuierliche Abnahme seiner Leibesfülle. Niemand von uns teilte seinen Opportunismus. Nach fast zehn Reisetagen sprach jedermann unter vorgehaltener Hand davon, dass die Situation geändert werden müsse. Unmöglich, sich mit gebührender Begeisterung Land und Leuten zu widmen, wenn vom Wüstenlicht geblendete Augenpaare den Horizont ständig gierig nach Anzeichen von Siedlungen absuchten, wo Essbares wie Bananen, Orangen, Erdnüsse und Brot aufzutreiben sein konnten. Es wäre einfach gewesen, in größeren Ortschaften genügend Vorrat einzukaufen, aber Bert verweigerte diese Art des Haushaltens strikt. Landkarten machten sicherlich aus kulinarischen Gründen viel häufiger die Runde von Hand zu Hand, als geographische Charakteristiken dies erforderten, allein zum Zweck, die Entfernung zum nächsten Ort festzustellen und damit die Stunden abzuschätzen, bis es wieder etwas zum Naschen geben würde.
»Einmal am Tag essen und frühstücken ist doch wirklich genug,« suchte Elsie den Unmut fröhlich zu dämpfen. Sie hatte vielleicht recht, aber wer als füllegewohnter Europäer den knurrenden Magen gar nicht mehr zum schweigen bringen kann, verschließt sich beleidigt solcherlei Wahrheiten.
Als wenigstens zweieinhalbtausend Kilometer an uns vorübergezogen waren, freuten wir uns immer noch auf die Reise, als habe sie noch nicht begonnen. Abgesehen vom Mangel an Essen stimmte irgendetwas von Anfang an nicht, bedrückte das Reisefieber, und wir schauten viel öfter müde vor uns hin, als begeistert hinaus, um die Facetten der neuen Landstriche kennenzulernen. Wir wurden durch die Gegend geschaukelt und gestoßen, und das Bild, das wir draußen vorüberziehen sahen, war jeweils ebensowenig klar, wie das, welches unser Inneres erfüllte. Seltene Gespräche mit Mitreisenden bestätigten, dass es nicht bloß einem allein so erging, dass schwärender Missmut das Innere auf eine Weise erfüllte, als sei es dem Platzen nahe. Man empfand den Reisealltag, als käme nichts aus dem übervollen Inneren heraus und als gelangte genausowenig etwas hinein.
Die Pflichten der Gruppeneinteilung erforderten ständige Anwesenheit im Lager. Für Freigeister wie mich schien das ein fataleres Übel zu sein als das Kochen. Mittlerweile existierte eine Liste, die unerbittlich dokumentierte, wer an welchem Tag was zu tun hatte. Nur spätabends oder noch vor Sonnenaufgang war es möglich, die Gruppe zu verlassen, um sich vom Lager zu entfernen und ein wenig allein zu sein mit sich und der Umgebung. Wir brachen so früh auf und hielten so spät zum Lagern an, dass schon allein deshalb kaum Muse zum Erkunden der Umgebung blieb, rechnete man die Zeit für Kocharbeiten und Lageraufbauen von der spärlichen Tagesfreizeit abseits der Fahrtetappen ab. Wir erlebten hauptsächlich die Dämmerzeiten im Freien.
Kaum imstande, die seltsam gedrückte Stimmung in Worte zu fassen, plauderten wir halbherzig über mangelndes Frühstück, Berts Ignoranz für unsere wiederholten Bitten um Fotostops, die Hektik bei Pinkelpausen. Es schien, als befänden wir uns wirklich auf der Jagd nach irgendetwas oder aber auf der Flucht. Dieser Gedanke kam der Wahrheit recht nahe, wie wir viel später erfahren sollten ...
Das ungeliebte Dahinbrausen begründete Bert immer noch damit, dass auf den kilometerlangen Wüstenpisten wohl nichts Lohnendes zu erkunden sei und wir besser daran täten, uns mehr Zeit für wirklich schöne Gegenden aufzusparen. Er hatte in diesem Fall recht. Dennoch begannen wir das Preschen, eingezwängt in »Uhurus« düsterem Inneren, zu verabscheuen. Wer immer vorne im Führerhaus saß, wurde hinten im »Uhuru« angefeindet, denn die Plätze neben Bert oder Brommel, je nachdem, wer gerade lenkte, galten als erstrebenswert. Dort war Leben, der Motor dröhnte zwar überlaut, doch die Anstrengung, möglichst laut zu sprechen hielt ebenso sehr wach, wie die Zugluft, die entstand, da beide Seitenfenster seit Beginn des Wüstenklimas fehlten abgenommen worden waren. Der Blick in die nahende, sich aufbäumende, vorbeiziehende Weite der Wüste vor dem Bug des Trucks beglückte jeden.
Hinten im »Bus« schmerzten bald die Augen, und undeutliches Schwindelgefühl stellte sich ein, fixierte man stundenlang vorbeiflitzende Sehenswürdigkeiten wie Autowracks, Dünengebilden und die Horizontlinie. Beim Aussteigen in der Öde der Sahara empfing uns dann die Hitze wie ein Schlag. Es war, als rannte man gegen eine gummiartige, biegsame Wand an. Die Helligkeit über der gelben Ebene blendete die Augen, wurde sie nicht vom Fahrttempo verzerrt und vom Fahrtwind gekühlt. Haltlos und verwirrt suchte der Blick nach Erhebungen in der Ferne, tastete ins Leere, ließ den Menschen taumeln unter blauem Himmel, der den allzu leichten Körper in die Höhe hinauf zu sich empor saugen wollte. Ich liebe die Wüste und wollte keine Sekunde darin missen, aber nicht alle Mitglieder unserer Reisegruppe waren wie ich und auch Anita sosehr bereit, jede Minute der Reise zu genießen, egal, wie sie ausfiel.
Читать дальше