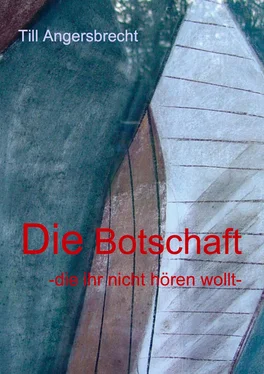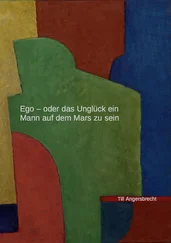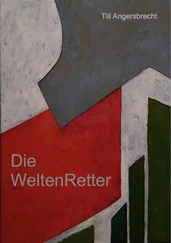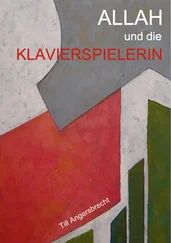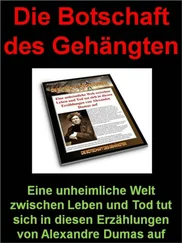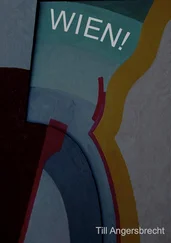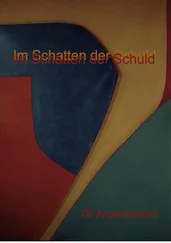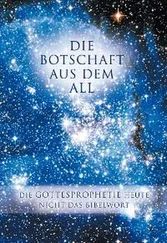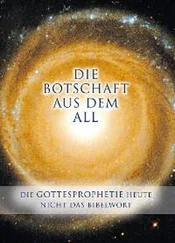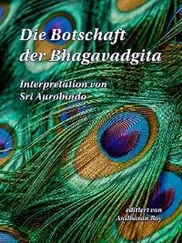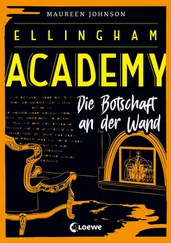Um es kurz zu machen: Ich habe mich ein oder zwei Sekunden später so weit gefasst, so verbissen zusammengenommen, dass ich mit dem bei solcher Gelegenheit üblichen Lächeln meine Hand ausstrecken und die Frau des Hauses begrüßen konnte. Ob Schdruschka meine kurzfristige Lähmung bemerkte? Ich glaube nicht, er wird meine Verwirrung auf die Blendung durch die Sonne zurückgeführt haben oder mich schlicht für einen jungen Mann mit ungeschickten Manieren halten. Für ihn musste mein Treffen mit Eveline den Anschein haben, als wären wir Fremde und ich seiner Frau an diesem Tag zum ersten Mal begegnet.
Das unerwartete Wiedersehen sollte nicht die einzige Überraschung an diesem frühen Samstagnachmittag sein, aber sie drängte alle übrigen Überraschungen weit in den Hintergrund. Es dauert einige Zeit, bis ich die Anwesenheit mehrerer anderer Gäste bewusst registriere. Alle haben sich rings um einen eichenen Gartentisch auf der Rückseite der Villa versammelt. Wie gesagt, gehe ich gegen die Sonne, als ich hinter Schdruschka und seiner Frau durch die offene Tür die auf der Rückseite des Hauses gelegene Terrasse betrete. Selbst die grandiose Landschaft, die sich wie auf einem Panoramaschirm vor mir öffnet, nehme ich zunächst gar nicht wahr, weil ich noch immer ihr Gesicht vor mir sehe, ihr völlig unbewegliches oder um die Mundwinkel vielleicht doch kurz aufzuckendes Gesicht. Es war ein herrlicher Ausblick auf den Wiener Wald, das bemerke ich erst jetzt, nachdem mein erstarrtes Inneres langsam aufzutauen beginnt.
Meine Befindlichkeit muss aber nicht jeden anderen interessieren, deswegen möchte ich gleich dazu übergehen, die außer mir selbst noch anwesenden Gäste vorzustellen.
Da nehme ich zunächst einmal eine gar nicht so kleine Berühmtheit wahr, nämlich Teddy Gernegut, der mir aufmunternd zuzwinkert, als wären wir vertraute Komplizen - dabei habe ich ihm bisher nur auf einer seiner zahlreichen Lesungen zwei- oder dreimal die Hand gedrückt. Er strahlt mich so freudig an, als hätte er die ganze Zeit auf nichts anderes gewartet, als mich gerade an diesem Ort und zu dieser Zeit seines besonderes Wohlwollens zu versichern. Es gibt so Leute, die immer den Eindruck der Familiarität verbreiten, allgemein sind das erfreulich Zeitgenossen, denn so wird einem die Begrüßung leicht gemacht. In meiner derzeitigen halb gelähmten Verfassung bin ich ihm dafür sogar dankbar. Im Übrigen kann sich Gernegut eine gewisse Herablassung durchaus leisten. Im Unterschied zu Schdruschka, dem möglicherweise verkannten Genie, wird er nicht nur bei uns in Wien gewürdigt, sondern hat sich im ganzen deutschsprachigen Ausland einen Namen gemacht. Mit seinem kürzlich erschienenen Roman “Selig – oder warum der Mensch von Natur aus gut ist“ gelang es ihm, in weiten Kreisen höchstes Aufsehen zu erregen; über Nacht hat ihn dieses Werk nicht nur in die Schlagzeilen der gängigen Literaturbeilagen gebracht, sondern berühmt, ja sogar beliebt gemacht: Endlich hätte da jemand – so das Votum der ihn bejubelnden Kritiker - den Mut aufgebracht, dem grassierenden Pessimismus ein Bild der Hoffnung entgegenzusetzen. Was mich betrifft, so bin ich über die ersten zwanzig Seiten des Buches allerdings nicht hinausgelangt. Selig ist eine fade Gestalt, an deren vielfältigen Liebesabenteuern vielleicht pubertierende Teenager ein aufgeregtes Interesse finden, aber gewiss kein Mensch von einiger Welterfahrung. Das Motto, das Gernegut seinem Opus zugrunde legt, lässt sich in etwa auf die Kurzformel bringen „Seid nett zueinander“, wobei die Gelegenheit, wo sich diese Einstellung vor allem bewähren soll, in dem Buch detailreich und auf vielen Seiten beschworen wird (Gernegut denkt da in erster Linie ans Bett). Diese Botschaft ist zwar modern, erscheint mir aber denn doch etwas schlicht, auch wenn ich dafür Verständnis habe, dass die Leute in einer so vielfach verunsicherten Zeit, wie es die unsrige ist, etwas Aufbauendes, Positives, freudig Bewegendes hören wollen. Je rauer ihnen die Wirklichkeit draußen vor der Haustür erscheint und manchmal auch in ihren eigenen vier Wänden, desto größer wird ihre Sehnsucht nach schönen Märchen des ewig Guten und Lieben. Gernegut ist ein Evasions-, ein Illusions-, ein Vorspiegelungskünstler, wie es deren heute so viele gibt. Das Augenzwinkern, womit er mich und vermutlich auch jeden anderen begrüßt, erscheint mir als ein ständiger Versuch, alle Menschen zu Komplizen bei dieser Wirklichkeitsverfälschung zu machen.
Deswegen denke ich gar nicht daran, zurückzuzwinkern, obwohl mir Gernegut, als er sich von seinem Stuhl erhebt, mit seinem ungebärdigen Wuschelkopf ganz nahe gekommen ist. Er drückt mir heftig die Hand, zieht diese aber gleich darauf wieder zurück, wie das so seine Art ist. Bei diesem Schriftsteller ist nämlich nichts von Dauer; von Natur aus neigt er zur Zappelei, eine Unart, die sich schon darin bemerkbar macht, dass er nervös auf dem weißen Gartenstuhl hin und her rutscht, ein Stück Gebäck aufnimmt, um es in seinen Mund zu führen, aber seine Absicht gleich wieder vergessend, lässt er es dann unberührt auf den Tisch zurückgleiten. Im Eifer des kommenden Gesprächs stellt er dieses Manöver sogar mehrfach mit der vor ihm stehenden Kaffeetasse an, die er zerstreut in die Höhe nimmt, um sie einen Augenblick später - vermutlich, weil irgendein Gedanke die Schaltzentrale in seinem Gehirn gerade zur Gänze belegt – ohne einen Schluck davon zu trinken, auf die schwere Eichenplatte zurücksinken zu lassen. Nun ja, das ist eben die Art dieses Mannes.
Neben ihm an dem mit Kaffee und Kuchen einladend gedeckten Tisch entdecke ich eine weitere Wiener Koryphäe - den allseits bekannten, man darf sogar sagen, allseits berühmten Physiker Platsch, den Entdecker des holographischen Prinzips und des „Weltkerns an sich“. Der Weltkern an sich, so das Fazit seiner gelehrten Forschung, sei aller direkten menschlichen Erkenntnis entzogen, ein pessimistischer Schluss, der den Physiker jedoch nicht zu der nahe liegenden Folgerung verleitet hatte, dass der forschende Mensch notwendig und für alle Zeit an eine unüberwindbare Barriere stößt; nein, Platsch behauptete – und das erst machte ihn zu einem weltweit bekannten Mann – dass dies nur ein scheinbares Hindernis auf dem Weg zu einem allumfassenden Wissen sei, denn dank des von ihm gefundenen holographischen Prinzips seien wir grundsätzlich in der Lage, auch im Kleinsten und Entferntesten den ganzen Kosmos sozusagen in nuce gespiegelt zu sehen - auf diesem Umweg könne der Physiker daher auch bis zum eigentlich verborgenen Weltkern vordringen. Das Prinzip der holographischen Spiegelung hatte Platsch nicht nur internationalen Ruhm beschert, sondern seine Laufbahn vor wenigen Jahren auch noch mit der höchsten Auszeichnung, dem Nobelpreis, gekrönt.
Im übrigen war Justus Platsch nicht wegen seiner Forschung berühmt, sondern durch seine Persönlichkeit auch berüchtigt, denn wo immer er erschien, verbreitete er Furcht und manchmal geradezu Schrecken. Sein ungewöhnliches Aussehen trug sicher ein Teil dazu bei: der Schädel war röhrenförmig und lief nach oben hin in eine Art von Zigarettenstummel mit aschgrauem Pelz von gestutzten Haaren aus. Dieser Anblick allein war geeignet, eine gewisse Erschütterung in sensiblen Naturen hervorzurufen, doch war es weniger seine körperliche Erscheinung als das Temperament des streitbaren Physikers, das so manchen verstörte, denn Platsch war für seinen Sarkasmus und seine grimmige Strenge bekannt. Ich wunderte mich daher, diesen großen Spötter und unbarmherzigen Kritiker aller Meinungen und Aussagen, die irgendwie im Ruch der Unwissenschaftlichkeit stehen, hier im Hause Schdruschkas anzutreffen, eines Astronomen von eher windiger Reputation.
Außer Gernegut und Platsch fällt mir noch ein weiterer Gast ins Auge, dessen Weg ich bei dieser Gelegenheit allerdings zum ersten Mal kreuze. Es handelt sich um einen gewissen Dr. Bonus Theophil, einen Theologen, der in der mittleren Hierarchie der Kirche den überaus wichtigen Platz eines Dogmenspezialisten oder „konsultativen Prälaten“ besetzt - darüber hatte mich Schdruschka gleich bei meiner Ankunft, noch bevor er mich seiner Frau vorstellte, in vertraulichem Ton belehrt. Natürlich hatte ich bei dieser Mitteilung, wie sich das so gehört, ehrerbietiges Erstaunen vorgetäuscht, so als könne einem wissbegierigen Journalisten wie mir gar nichts Interessanteres geschehen, als einem konsultativen Prälaten zu begegnen. In Wirklichkeit hätte mich Schdruschka auch mit einem weißen Elefanten bekannt machen können. Ich kann mir nämlich nichts, wirklich gar nichts unter einem konsultativen Prälaten vorstellen, außer dass dieser Mann etwas mit Gott und den höheren Sphären zu tun haben muss.
Читать дальше