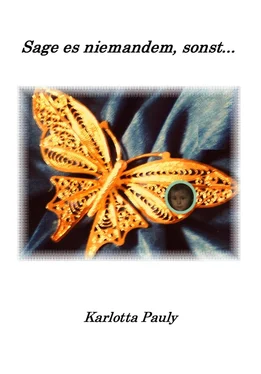Mein Vater machte dann eine Entziehungskur, da alles auf den Alkohol zurückgeführt werden sollte. Es machte einen besseren Eindruck, wenn er sich vor dem Prozess in eine Therapie begab. Er ging für ein halbes Jahr nach Schleswig in das Landeskrankenhaus (Psychiatrie). Meine Mutter suchte sich eine Stelle als Reinmachefrau in einer Schule, da der Aufenthalt privat bezahlt werden sollte. Meine Mutter fuhr jeden Sonntag nach Schleswig und besuchte meinen Vater. Einmal musste ich mitfahren. Ich war doch erst dreizehn. Für mich war mein Vater in einem Krankenhaus. Als wir dann auf dem Gelände von einigen geisteskranken Menschen angesprochen wurden, machte mir das große Angst. Doch wir durften dann das Gelände verlassen und haben uns die Stadt angesehen und den Dom und mein Vater war wieder der Riese, der alles bestimmte und zu dem ich in Angst aufsah.
Was bin ich da an diesem Tag überhaupt gewesen? Ich bin etwas, was man benutzt hat, um den Ärzten eine heile Familie vorzustellen und dem Vater das Gefühl des Familienoberhauptes zu geben, was ich dann auch deutlich zu spüren bekommen habe. Er ist immer noch auf seinem Podest, allwissend, herrisch, bestimmend, ich bin so klein und habe überallhin zu folgen.
Ich weiß nicht mehr wie wir nach Hause kamen, irgendwann brach dieser Tag für mich mittendrin ab. Was für mich von diesem Tag blieb, waren meine Eindrücken von den Kranken, von einem riesengroßen Vater, der, obwohl er etwas Schlimmes getan hatte, nicht kleiner wurde, und einer Mutter, die eigentlich gar nicht da war.
Was ich dann zu Hause in der nächsten Zeit mitbekam war, dass mein Vater nachts die Klinik heimlich verließ – undenkbar, dass er über einen Zaun stieg und sich das Zeug zerriss. Er trank. Er wurde rausgeworfen. Er kam wieder nach Hause.
Kaum war er da, wurde er polizeilich überwacht. Das machte ihn sehr nervös. Er trank weiterhin. An einem Sonntagmittag kam er nach Hause und meine Mutter hatte ihm einen Brief auf den Nachtschrank gelegt. Es war ein amtliches Schreiben. Nach einer Weile hörten wir einen merkwürdigen Laut. Meine Mutter rannte ins Schlafzimmer, ich hinterher. Er lag auf seinem Bett, hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten, überall war Blut. Plötzlich waren mehrere Polizisten im Zimmer. Auf dem einen Bett lag mein Vater, auf dem anderen Bett saß meine Mutter und weinte. Ich saß neben ihr und tröstete sie. Ich hörte, wie mein Vater immer wieder jammerte: „Ich sterbe, ich werde sterben“. Ein Polizist sagte sehr hart zu ihn: „So schnell stirbt man nicht!“ Irgendwann sagte jemand, bringen sie doch das Kind hier raus. Aber keiner tat es, ich hätte mich auch nicht rausbringen lassen. Ich musste doch bei meiner Mutter bleiben, obwohl sie mich gar nicht bemerkte. Dann kam ein Krankenwagen und meine Mutter fuhr mit meinem Vater ins Krankenhaus.
Dann kam sie allein wieder. Sie sagte uns, dass sie ihn im Krankenhaus lassen musste. Der Arzt hatte ihr gesagt, dass ein Mensch der Hand an sich legt, das nächste Mal Frau und Kindern etwas antut. Dieser Satz verfolgte mich die nächsten Jahre und stürzte mich immer wieder in schreckliche Angst.
Wie kann ich das Gefühl eigentlich aushalten? Wie konnte ich das überhaupt als Kind aushalten.
Jeder von uns verzog sich scheinbar in sich selbst, besonders meine Mutter. Mein Bruder wurde zum Familienkasper und zum Tyrannen für mich, mein großer Bruder ging schon aus dem Haus und hatte Freunde. Ich hatte niemanden und war für alle sowieso noch zu klein. Außerdem konnte ich mich nicht nach außen öffnen, da ich schon so lange gelernt hatte, dass das was bei uns war, niemanden etwas anging. Und da ich nirgends hingehen durfte, wusste ich nicht einmal, wie es in anderen Familien war und hielt unser Leben auch noch für normal.
Aber erst einmal war Ruhe bei uns. Mein Vater wurde wieder nach Schleswig verlegt, aber in die geschlossene Abteilung und meine Mutter nahm mich nie wieder mit.
Dann kam der Prozess. Das Urteil fiel milde aus und mein Vater wurde von Tag zu Tag unberechenbarer. Ich war inzwischen ca. 15 Jahre alt, war in dieser turbulenten Zeit konfirmiert worden. Das Fest mit der Familie ist nicht erinnerungswürdig.
In der Therapie bin ich bis hier gekommen. Doch dann habe ich einfach Angst vor dem, was weiter geschieht. Ich muss die weitere Aufarbeitung verschieben, aber es lässt sich nichts unterdrücken. Ich muss es aussprechen, es aufschreiben. Ich muss mich der Erinnerung an die schlimmsten Nächte meines Lebens stellen. Ich habe diesen Zustand wohl über ein Jahr lang ertragen.
Ich brauche mehrere Monate, bis ich dieses Fach in meiner Seele öffnen kann.
Es änderte sich die Verteilung der Räume in unserer Wohnung. In der Zeit, als mein Vater im Krankenhaus war, schlief ich in seinem Bett. Als er zurückkam, wurde ein Bett ins Herrenzimmer gestellt. Ich blieb im Elternschlafzimmer. Wir hatten alle Angst vor meinem Vater und ergriffen Vorsichtsmaßnahmen. Die Schlafzimmertür wurde nachts abgeschlossen und meine Brüder hatten „Waffen“ unter ihren Kopfkissen (Gaspistole und Schlagring). Das war für uns alle bald normaler Alltag.
Aber was sich in meiner Seele abspielte, war nicht auszuhalten. Die Angst war unmenschlich. Irgendwann in der Nacht fing ich an zu zittern, dass die Ehebetten wackelten. Ich spürte, wie das Auto meines Vaters sich unserem Haus näherte, ich spürte, gleich wird die Autotür klappen, gleich wird der Schlüssel sich in der Haustür drehen, und gleich werden seine Schritte auf der Treppe zu hören sein. (Das war Auslöser für die Panikattacke in der Klinik).
Das war meiner Mutter unheimlich, aber noch unheimlicher war mein Zittern. Sie lag hilflos daneben und brachte es nicht fertig, mich zu berühren. Ich war allein. Ich musste es aushalten.
Aber bei dem, was dann kam, wenn mein Vater die Wohnung betreten hatte, war ich noch einsamer. Ich hatte Angst, dass er das Essen vergiften könnte, weil er doch nach Aussage des Arztes uns etwas antun könnte. Wir waren ja durch die verschlossene Tür geschützt, aber es gab doch noch andere Möglichkeiten. Doch darüber konnte ich nicht sprechen. Dann würden die anderen mich auslachen oder auch in Angst geraten, und das konnte ich meiner Mutter oder meinen Brüdern nicht antun. Ich horchte also genau auf alle Geräusche und das Gemurmel meines Vaters. Er ging immer in die Küche, guckte in die Töpfe, die mit dem Essen für den nächsten Tag auf dem Herd standen und aß auch manchmal davon, obwohl es kalt war.
Durch die kleine Scheibe in der Schlafzimmertür konnte ich sehen, wenn endlich das Licht in der Wohnung ausging. Dann wurde ich wieder ruhiger.
Am nächsten Tag, wenn meine Mutter zur Arbeit war, musste ich dieses Essen warm machen für meine Brüder und für mich. Wenn ich davon essen würde, war es mir egal, aber wenn meine Brüder aßen, war die Angst wieder da. Wenn das Essen jetzt nicht in Ordnung war, hatte ich es meinen Brüdern gegeben. Unvorstellbar.
Am Tag hatte ich dann viele Aufgaben zu erledigen, so dass ich nicht viel an die Nächte denken konnte. Am nächsten Morgen ging ich in die Schule mit der Angst, dass er meiner Mutter etwas antun könnte. Aber ich musste lernen, ich musste in der Schule gut sein. Bei schlechten Noten bekam ich sonst Ärger. Auf dem Heimweg traf ich dann meine Mutter, die zur Arbeit ging. Bis ich sie endlich sehen konnte, war es die Hölle für mich, ich rannte, um schneller bei ihr zu sein und zu sehen, dass ihr nichts passiert war. Dann trennten sich unsere Weg wieder. Zu Hause war keiner, ich war wieder allein.
Irgendwann kam vielleicht mein Vater, dem ich das Essen warm machen musste. Danach verließ ich schnell die Wohnung, ich hatte immer meine Jacke und den Schlüssel bereit gelegt. Wenn er wieder gegangen war musste ich auf meine Brüder warten, das Essen warm machen, und sie bedienen.
Читать дальше