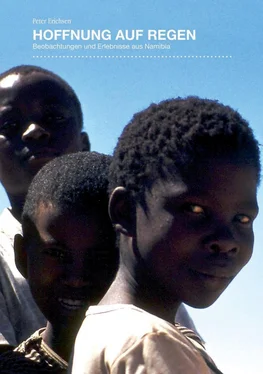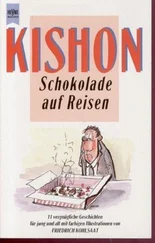Das Haus – oder besser – die beiden Häuser sind in Karibib erste Wahl. Sie sind solide gebaut und stehen auf einem großzügigen Grundstück mit vielen Bäumen und einer herrlichen Sicht auf den Erongo.
Was brauchen wir mehr! Ich messe das Vorgefundene an meinen Erwartungen und bin erleichtert. Innen wird noch gearbeitet: Schwarze machen die Wände weiß.
Das Wichtigste ist somit erledigt. Jan und ich verspüren Lust auf eine kleine Stärkung, bevor wir nach Windhoek starten. Unten an der Ortsdurchfahrt haben wir einen Bäcker gesehen, in einem Haus mit alter Fassade aus deutscher Zeit und einer dicken Dattelpalme davor. Es ist ein ehemaliges Hotel aus den Gründungstagen Karibibs, also rund 80 Jahre alt. Der lange Gebäudeflügel, der die Seitenstraße hinaufreicht, ist der ehemalige Schießstand. Wir betreten die schattige Veranda und öffnen die mit Fliegendraht bespannte Holztür zum Laden. Sie schwingt auf, und wir stehen in einem hohen Raum mit stuckverzierter Decke. Hinter dem Ladentisch die Brotregale, rechts vor dem Tresen ohne weitere Abtrennung einige Tische und Stühle: Der Laden ist gleichzeitig ein nach unseren bisherigen Maßstäben nicht besonders einladendes Café.
Ein schmächtiger Schwarzer mit Schlips und weißer Bäckerjacke sieht uns freundlich fragend an. Die Verständigung ist kein Problem, er spricht gut Deutsch. Er geht, um uns die beiden belegten Brötchen zu holen, die wir bestellt haben. Wir sind allein und schauen uns um. Da öffnet sich links eine weiß lackierte Tür mit der Aufschrift „Privat“, heraus tritt ein fülliges, gelangweiltes Gesicht mit dunklen, glatt zurückgekämmten, zu einem Knoten gebundenen Haaren, eine kleine Frau in schwer zu schätzendem Alter, mit schwarzen Augen hinter dicken Brillengläsern. Sie schlendert hinter dem Ladentisch entlang und entgleitet unseren Blicken dort, wo auch der Schwarze verschwunden ist.
Wir wundern uns noch über den stummen Auftritt, da springt plötzlich die eiserne Ladenkasse mit einem lauten Klingeln auf, weil Jan sich auf dem Tresen etwas weit vorgebeugt und beim Aufstützen einen Hebel berührt hat. Wir lachen über unseren Schreck, und augenblicklich steht die Frau vor uns. Diesmal sieht sie böse aus. „Was soll denn das?“, will sie wissen, sie vermutet wohl Absicht. Ich lache sie an, erkläre die Harmlosigkeit des Vorfalls. Da öffnet sich zum zweiten Mal die weiß lackierte Tür und heraus tritt – wieder ein Grund zu erschrecken – ein riesenhaft wirkender, massiger Mann mit Dreiviertelglatze und bärbeißiger Miene. Er stapft den gleichen, schon beschriebenen Weg und verschwindet ohne Ton.
Was haben wir nur getan! Der Kunde fühlt sich irgendwie für irgendwas schuldig. Vielleicht sind wir nur lästig? In einem einsamen grauen Fischerdorf an der rauen irischen See hätte mich ja eine derartige Begegnung nicht weiter verwundert – obwohl ich noch nie in einem einsamen grauen Fischerdorf an der rauen irischen See war. Aber hier? Unter der ewigen Sonne?
Auch so ein Vorurteil, mit dem wir fertig werden müssen: Ewige Sonne garantiert keine heitere, mediterrane Lebenskunst, und wo die Menschen lachen, muss nicht die Sonne scheinen. Das kann ja heiter werden, denke ich.
An der Tankstelle lassen wir einen älteren Schwarzen zusteigen. Es beginnt leicht zu regnen. Wieder liegen rund 200 Kilometer vor uns. Ich setze mich ans Steuer, um zu üben. Alles ist neu: Der Einstieg ist hoch, der Fahrersitz auf der rechten Seite, das Zündschloss links, und der Schlüssel muss nach links gedreht werden. Der Blick durch das schmale Viereck der Windschutzscheibe ist so großartig, weil ich nur die Perspektive eines europäischen Mittelklasse-Wagen-Fahrers kenne...
Der Wagen kommt nur langsam auf Touren und macht einen fürchterlichen Krach. Die Motorhaube rüttelt auf und nieder, die Türen hängen luftig in ihren Rahmen und lassen frische Luft herein, die Scheibenwischer sind keinen Regen gewöhnt, und der blinde Rückspiegel dreht sich beharrlich verschämt zur Seite.
Ich hab mich auf diesen ersten Einsatz im Südwester Linksverkehr gefreut und ich genieße es auch. Zweieinhalb Stunden brauchen wir und überwinden eine Steigung von ungefähr 600 Metern. Gespannt beobachte ich den entgegenkommenden Verkehr – zunächst scheint es so, als habe es jeder auf einen Zusammenstoß abgesehen. Wenn ich einmal vor mich hinträume und es taucht urplötzlich jemand vor mir auf, so fährt mir ein richtiger Schreck in die Glieder. Aber der Linksverkehr funktioniert, und der Landrover lärmt zuverlässig mit 100 Stundenkilometern voran – 90 sind nur erlaubt.
Es ist schwül, ich habe Kopfschmerzen. Bei Okahandja, dem einzigen Ort an der Strecke, löst Jan mich ab. Eine Pavianherde überquert vor uns die Straße. Die schwarzbraunen Gesellen mit ihren vorgestreckten Kiefern und den engstehenden Augen haben es dabei nicht besonders eilig. Besonders die Größeren können die Geschwindigkeit des nahenden Autos gut einschätzen. Die bei uns sprichwörtliche Rötung der Pavianärsche ist bei diesen Affen nicht zu sehen. Nach und nach verschwinden die dunklen Flecken hinterm Farmzaun im Busch, nur die Nachhut sitzt noch halb im Gras verborgen und beobachtet uns scheinbar gleichgültig, während wir vorüberrattern.
Über breite, autobahnähnliche Straßen erreichen wir in der Dämmerung Windhoek: das Kraftwerk mit den zwei Schloten, das Hospital-Hochhaus von Katutura und links und rechts ein Teppich von Einfamilien-Wohnhäusern, der auch schon die vielen Berghänge bedeckt, von denen die Stadt umgeben ist.
Am nächsten Morgen entdecke ich, dass Windhoek auch eine City hat. An der belebten Kaiserstraße stehen Häuser mit zehn, zwölf Stockwerken, dazwischen eingekeilt ein paar Exemplare aus der deutschen Zeit, vom Hang herab schaut die Christuskirche. Denkmäler, Parkplätze, Anlagen. Vielrassiges Gesicht der Straßen: Elf ethnische Gruppen tummeln sich hier, ein faszinierendes Durcheinander von hässlich und schön, von weiß, braun und schwarz und allen möglichen Mischungen daraus. Kein äußerlich erkennbares Zeichen für Rassismus, für Hass, für eine gespaltene Gesellschaft. Selbstbewusst und gut gekleidet die meisten Farbigen, braun uniformierte Soldaten, meist ohne Waffen, die sich wie selbstverständlich in der Menge bewegen, die Herero-Frau, die in ihren bunten Kleidern aus kolonialer Zeit am Eingang des Kalahari-Sands-Hotels sitzt und Trachtenpuppen anbietet – kein Eindruck von Beklommenheit, keine atmosphärischen Störungen, nach denen der eingereiste „Deutschländer“, der „Dscherrie“, misstrauisch Ausschau hält. Oder doch? Vielleicht durch einen der zahlreichen Zeitungsjungs, der mir nun zum vierten Mal die AZ, die „Allgemeine Zeitung“, anbietet: Zerlumpt könnte man ihn schon nennen, und rührend sind seine Anstrengungen, ein paar Cents zu verdienen – angesichts einer ganzen Armee von Zeitungsverkäufern, die alle das gleiche wollen und viel zu viele Zeitungen auf ihren nackten Armen tragen.
Aber ich habe nicht viel Zeit, mir alles anzusehen. Ich will heute noch zur Farm zurück, das sind schätzungsweise fünf Stunden Fahrt.
Im Büro der Spedition erfahre ich wenig Erfreuliches. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Zoll. Da ist zunächst der Mercedes, den ich auf Anraten meiner künftigen Karibiber Heimat gekauft habe. Die Mitnahme eines PKW hat mir meine vorgesetzte Behörde, das Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln, grundsätzlich nahegelegt.
Eigentlich steht mir ein Wagen mit derartigem Hubraum gar nicht zu. Für die Beamten ist alles penibel geregelt: Einer Familie mit drei Kindern wird nur ein Auto bis zu 1700 ccm kostenlos transportiert. Aber der Sachbearbeiter hat mich beruhigt: Es handele sich ja um einen gebrauchten Mercedes. Also grünes Licht! Nicht lange nachgedacht über Sinn und Unsinn von Vorschriften, nicht lange nachgedacht über menschliches Versagen am Schreibtisch. Ich habe die ganz starke Meinung, auf so unsicherem Terrain meiner vorgesetzten Behörde blind vertrauen zu dürfen. Wozu gibt es Fachleute?
Читать дальше