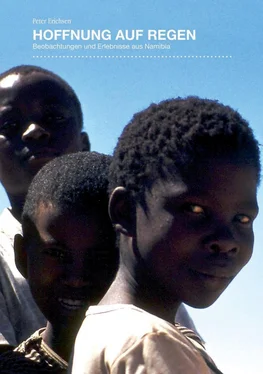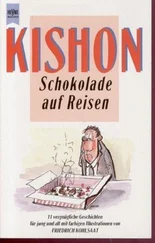1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 So schnappe ich mir den braunen Filzhut mit der Leopardenfell-Imitation, den ich in Otjiwarongo erworben habe, und klettere über die heruntergelassene Heckklappe auf die Ladefläche des Isuzu-Bakkie, neben mir einer der Terrier für den Fall, dass ein angeschossenes Tier gestellt werden muss.
Wir fahren zunächst zur Locasi und holen zwei Arbeiter ab: Der eine übernimmt das Steuer, der andere stellt sich mit Hinrich auf die Ladefläche. Hinrich gibt seine Anweisungen auf Afrikaans, der Sprache der Buren, aber ich glaube, auch etwas Altländer Platt herauszuhören.
An den Krälen vorbei geht es am Damm7, dann am Maisfeld entlang, bis wir die Camps im Nordosten erreicht haben, die günstig im Wind liegen – allerdings, viel Wind herrscht heute nicht, und das ist gut so. Das Wild verlässt dann eher den schützenden Busch. Wir halten uns stehend an dem Gestänge fest, das die niedrige Fahrerkabine von der Ladefläche trennt, und müssen ein paar kräftige Schlaglöcher abfedern.
„Pass auf!“, raunt Hinrich mir zu. Ich schaue zur Seite. Hat er etwas gesehen? Da reißt es mir plötzlich den Hut vom Kopf. Einer der überhängenden dornigen Akazienzweige war es, und ich bin gewarnt. „Der alberne Kinnriemen ist doch zu was nutze“, denke ich. Wir fahren flott dahin, und er hält den breitkrempigen Hut auch fest, wenn der Fahrtwind darunterfassen will.
Unsere aufgeheizten Körper kühlen sich angenehm ab, obwohl die Sonne noch hoch steht. Es ist still um uns, das Geräusch des Motors bemerkenswert leise und gleichmäßig, der niedrige Isuzu schleicht auf seinen weichen Schläuchen wie auf leisen Sohlen an den Zäunen entlang. Aufdringlich polternd und sich selbst überschlagend schreit ein Sandhuhn in unserer Nähe, dumpfe Flügelschläge ersterben im Busch.
Hinrich gibt mir ein Zeichen. Wir sollen jetzt nicht mehr reden. Das vertraute und immer gleich bleibende Motorengeräusch dagegen weckt nicht den Argwohn der scheuen Antilopen.
Warme Schwaden von Luft tragen würzigen Kräuterduft und Geruch von Rinderdung und feinen Staub.
Zahlreiche Fährten führen über steinlosen Sand, an manchen Stellen verdichtet zu Pfaden, an weggebogenem Draht vorbei unter dem Zaun hindurch – die Schlupflöcher der schwarzweiß
maskierten Oryx mit ihren gefährlichen Kopfspießen.
Hinrich deutet stumm voraus. Ich sehe ganz da hinten in vielleicht 600 Meter Entfernung ein paar dunkle Punkte auf der Pad. Ein fast unmerklicher Schlag auf das Wagendach, und der schwarze Fahrer hält mit laufender Maschine. Durch das Glas erkennen wir Warzenschweine. Wir fahren weiter.
Ich versuche, mit meinen Augen flink hin- und herzuspringen, das heranflitzende Gestrüpp zu durchdringen. Einmal sehe ich links ganz kurz an einer lichten Stelle ein kleines, rehähnliches Tier, wahrscheinlich ein Steinböckchen, das kurz verhofft mit großen schwarzen Augen und dann in wildem Erschrecken ins Dickicht stürzt.
Plötzlich ist Hinrich verschwunden. Etwas verwirrt schaue ich mich um, ohne das Gestänge loszulassen. Aber ich sehe nichts, der Wagen fährt ruhig und gleichmäßig. Das gibt’s doch nicht! Der Schwarze neben mir bemerkt meine Verwirrung und zeigt nach hinten. Jetzt sehe ich Hinrich, der versucht, in den Busch einzudringen. Er bewegt sich schneller als sonst, fast hastig. Offensichtlich fehlt ihm freies Schussfeld. Jetzt bleibt er stehen, reißt das Gewehr hoch und schießt sofort.
Wir halten, das Motorengeräusch verebbt, Stille bricht über uns herein. Es dauert eine Weile, bis sich meine Ohren umgestellt haben. Wir horchen bewegungslos, und dann hören wir rechts auf unserer Höhe, wie die Zweige knacken, und die dumpf schlagenden Hufe des flüchtenden Wilds.
Die Jagd ist vorbei, der Schuss misslungen. Es ist wohl auch schwer, in den Busch hineinzuschießen. Aber das macht nichts. Gleichmütig steigt Hinrich wieder auf.
Wie ein Jäger sieht er ja gerade nicht aus, mit seiner stämmigen Figur in knielangen Shorts, dicken Kniestrümpfen und kurzärmeligem Hemd. Auf dem Kopf trägt er einen normalen, nicht mehr ganz modernen Herrenhut. Hinrich legt keinen Wert auf zünftige Ausstattung. In Deutschland sähe er das vielleicht anders, aber hier in Afrika? Wozu? Die Jagd gehört für den Farmer zum täglichen Leben, da wirkte eine spezielle Uniformierung unnatürlich und lächerlich.
„Und wenn du einen Jagdgast aus Deutschland hast,“ doziert er auf seine lustig-dramatisierende, theatralisch-händeringende Art, „und du hast ihm den kapitalen Bullen zugeführt, den er nun glücklich erlegt hat, und das stolze Tier liegt vor ihm mit seiner prächtigen Trophäe und den gebrochenen Lichtern, dann musst du ihm den Bruch ins Maul stecken, das nennt der deutsche Weidmann ‚Den letzten Bissen’, und ein Stück davon überreicht ihm feierlich der Schwarze und sagt dazu auf Deutsch ‚Weidmannsheil!’ Dann sollst du mal den Jäger sehen! Tränen in den Augen! Das mag er! Sowas Schönes! Dafür gibt er alles, was er hat! Dafür kannst du auch hundert Rand mehr von ihm nehmen!“ Und Hinrich grinst verschmitzt.
Doch Jagdgäste haben sie nur selten, ein- bis zweimal im Jahr. Damit verdient sich seine Frau ein bisschen Geld, dafür, dass sie für Unterkunft und Verpflegung sorgt. Ein leichtes Geschäft ist das nicht. Lustig und interessant können die Leute sein, aber auch fürchterlich anstrengend mit ihrem vielen Geld, wenn sie ein Drei-Sterne-Hotel im afrikanischen Busch verlangen und die Farmersleute als ihr Personal betrachten oder wenn sie als richtige Männer bis zum frühen Morgen mit ihrem Jagdführer Whisky saufen. Außerdem müssen Vorschriften des Staates beachtet werden, will man nicht die Anerkennung als Jagdfarm verlieren – von der Qualifikation des Jagdführers bis zum Bettvorleger im Gästezimmer ist alles geregelt.
Er persönlich, sagt Hinrich, sei kein Trophäenjäger, sondern ein Fleischjäger. Von Zeit zu Zeit verschaffe er seinen Schwarzen Wild, und jetzt sei das mal wieder soweit. „Morgen können wir das ja nochmal versuchen.“
Am nächsten Abend sind wir wieder unterwegs. Wir fahren ein Stück auf der breiten, rotsandigen Farmpad entlang, weil Hinrich es heute auf der nördlichen Grenze seiner Farm versuchen will. Überall liegen die schwarzgrünen Kothaufen der Rinder, die in diesem Padcamp weiden. Eine Schar von Perlhühnern läuft ins schützende Gras, als wir näherkommen. Blaugrau schillert ihr weißgesprenkeltes Gefieder, hoch ist ihr Rücken, und der Körper an den Seiten eigenartig flachgedrückt, der Kopf bunt, mit vor allem leuchtenden Rot. Das Fleisch der jungen Vögel soll gut schmecken, aber die meisten Farmer lassen die Finger davon. Die ewig scharrenden und fressenden Perlhühner sind gute Insektenvertilger und halten vor allem die Termiten kurz.
Und Insekten gibt es im Moment reichlich. Das zeigen auch die „Regenvögel“, die heute in ungewöhnlicher Zahl schwarz am Himmel kreuzen. Es sind Schmarotzermilane, also Greifvögel, die ebenfalls dort gerne massenhaft auftreten, wo es eine Massenvermehrung von Insekten gibt. Vielleicht fliegen die Termiten schon, oder die ersten Heuschrecken haben sich in der Nähe auf den Weg gemacht...
Nun fahren wir an der nördlichen Farmgrenze in Richtung Westen, auf den markanten Paresis-Berg zu. Wir achten vor allem auf die rechte Seite, denn das Wild, das links steht, dürfen wir nicht jagen. Es befände sich auf fremdem Grund und Boden. Auch ein dorthin fliehendes Tier hätte von uns nichts mehr zu befürchten. Andernfalls gäbe es mit dem Nachbarn, bei aller Freundschaft, schwerste diplomatische Verwicklungen.
Aber wir legen mehrere Kilometer zurück, ohne jagdbares Großwild zu entdecken. Wieder kein Fleisch!
Am Paresis-Berg müssen wir wieder nach Norden abbiegen. Die Hänge sind weder eben noch glatt, sondern übersät mit Felsbrocken – typisch für dieses Land. Hier gibt es immer wieder Leoparden – und natürlich Paviane, ihre häufige Beute.
Читать дальше