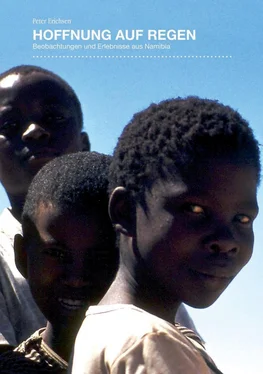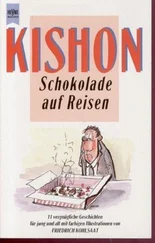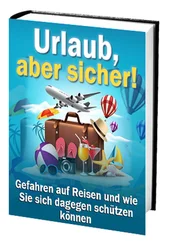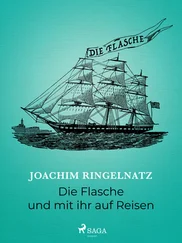Wir lernen Antje und Werner Drechsler kennen, die beide an meiner künftigen Schule unterrichten. Sie heißen uns willkommen und laden uns ein, ihr Häuschen liegt um die Ecke. Zusammen mit Familie Seitz sind wir abends auf der Terrasse der Drechslers und genießen eine unbeschreibliche Stimmung. Die sandige Plattform, auf der wir sitzen, ist am Haus von einem schwarzen Schattennetz überdacht, mit Sträuchern und blühenden Gewächsen durchgrünt und thront halbkreisförmig über dem tiefer liegenden Garten. Durch das schwarze Filigran des Pfefferbaumes mit seinen dünnen, hängenden Zweigen und den langen, fein gefiederten Blättern glänzt das warme Licht der schnell sinkenden Sonne. Weiter unten ist alles, was an Zivilisation erinnert, hinter grünen Baumkronen verborgen, und der Blick auf den Erongo in majestätischem Graublau ist unverstellt. Bald ist der Sonnenball im Westen verschwunden, und die Berge sind jetzt tiefschwarze, scharfe Silhouetten vor der gewaltigen Bühne des untergehenden Tages.
Aber es ist noch warm über dem dunklen Buschland, und hundertstimmiges „Geck – Geck“ dringt zu uns herauf, die Stimmen der kleinen Echsen, Geckos genannt, die sich auch in den Schlupfwinkeln der Häuserfassaden gern aufhalten.
Und in unserer Runde flackert ein Feuer und kocht Fisch im Dreifuß-Topf. Wir essen und singen und trinken Kapwein, verstehen uns gut und sind durch und durch zufrieden.
Meine künftige Wirkungsstätte hab ich mir natürlich schon vor Tagen angesehen – zuerst vorsichtig mit Abstand von außen, und dann in das Innere eindringend unter Führung Jan Kolbergs. Mein erster Eindruck ist ganz gut. Die relativ neuen Gebäude wurden um einen Schulhof herum gebaut, der etwa quadratisch ist, mit Platten belegt und durch drei natursteinummauerte Beete verschönt. An einer Fahnenstange hängt ein Stück Rohr, mit dem man Schallzeichen geben kann, wenn die Klingel einmal ausfällt.
Am Eingang an der Straße blüht eine Hecke, und eine kleine Dattelpalme kämpft sich mühsam durch den steinigen Boden. Ein großes Wappen mit einer Lilie und der Jubiläumszahl 75 daneben ziert die Wand des flachen Verwaltungsgebäudes. Hier ist das kleine Sekretariat untergebracht, der Arbeitsplatz von Uschi Seitz, der Frau meines vermittelten Kollegen. An der Schulhofseite werden die Räume dieses Gebäudes durch einen überdachten Schattengang erreicht. Der wichtigste Raum für mich ist das schmucklose Lehrerzimmer mit Holzstühlen und resopalbeschichteten Tischen, einer kleinen Teeküche und einer Lehrerbücherei voller Staub und heilloser Unordnung.
An der Westseite des Hofes steht das Turnhallengebäude, in dem auch Nebenräume wie Kegelbahn, Bibliothek, Kühlraum für Heimvorräte und ein Tagungsraum untergebracht sind. Die kleine Turnhalle mit Parkettfußboden und Empore hat außerdem eine Bühne, wird also als Mehrzweckraum genutzt.
An der Nordseite steht ein einstöckiges Haus mit sechs Klassen – die oberen drei werden durch eine Außentreppe und einen Außengang erschlossen. Schmucklos sind die Räume auch hier, und ebenfalls mit recht abgenutztem Mobiliar ausgestattet. Hinzu kommen noch zwei ältere Gebäude an der Ostseite mit den Fachräumen und den Klassenzimmern für die ganz Kleinen.
Der Luxus und die Perfektion bundesdeutscher Fachräume,
insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich, können hier kein Maßstab sein. Deshalb bin ich auch nicht enttäuscht über das Alter der Einrichtung und den Grad ihrer Abnutzung, über die Provisorien und den Staub. Ich hab damit gerechnet, improvisieren zu müssen oder auf manche Inhalte zu verzichten.
Das Schulgelände ist sehr weitläufig, große, steinige Freiflächen gehören dazu und sogar ein Tennisplatz – wenn auch mit gerissenem Betongussboden.
Auf der anderen Seite der Straße liegt das Heim. Das sind mehrere langgestreckte, barackenähnliche Gebäude mit Innenhöfen und viel Platz drumherum. Im Zentrum steht der Ess-Saal mit seinem repräsentativen, Marmor verzierten Eingang.
Auf den Freiflächen existierte früher ein richtiger Privatzoo. Brüchige Verschläge und Maschendrahtwände zeugen davon. Ein paar Truthähne und Enten laufen noch herum – und sogar zwei Paviane. Ansonsten ist das Gelände völlig verwildert.
Reptilien hat es gegeben, auch Antilopen. James Krüss war einmal hier (1966) und hatte ein Erlebnis mit einem Warzenschwein. Er schrieb darüber ein Gedicht und verhalf dem Heimzoo und damit auch der Privatschule (PSK) zu einem gewissen Ruhm, von dem man noch heute zehrt. Auf jeden Fall wurde das Gedicht in das Lesebuch für die unteren Klassen aufgenommen und wird nach wie vor stolz auswendig gelernt.
Den Schulen in Namibia sind fast immer Heime angeschlossen. Zu weit verstreut wohnen die Menschen, Schulen können deshalb nur an zentralen Orten eingerichtet werden, wo die Kinder in Heimen wohnen. Besonders weiße Farmkinder sind hiervon betroffen. Aber es gibt rassische, ethnische und damit auch politische Komplikationen, die eine normale Schulversorgung zusätzlich erschweren.
Der Einzugsbereich der PSK reicht vom 200 Kilometer nördlich liegenden Otjiwarongo bis zum 400 Kilometer südlich liegenden Marienthal. Diese gewaltige Streubreite ist nicht durch Zentralisation der Bildungsangebote allein zu erklären. Zwischen Otjiwarongo und Marienthal gibt es mindestens drei andere deutsche Schulen, die aber zum Leidwesen der deutschbewussten Südwester staatliche Schulen sind. Ihr Besuch ist zwar kostenlos, aber sie richten sich nach südafrikanischen Lehrplänen, Organisations- und Erziehungsmethoden. Ihnen fehlt die direkte Verbindung zu dem, was das heutige Deutschland ausmacht, es fehlen deutsche Lehrbücher und deutsche Lehrer. Die Pflege der deutschen Sprache, seit etwa 70 Jahren das Hauptanliegen der Deutschstämmigen, will man nicht unbedingt denen überlassen, die eine andere Muttersprache haben oder die selbst der „Pflege“ bedürfen.
Also kommt nur eine deutsche Privatschule in Frage, die materiell und personell erheblich durch die Bundesrepublik unterstützt wird. Aber da gibt es ja in Windhoek die wesentlich größere und leistungsstärkere DHPS (Deutsche Höhere Privatschule). Wer in Marienthal oder Windhoek wohnt, könnte also 200 Kilometer sparen – wenn die Rivalitäten nicht wären.
Die PSK hatte es nämlich immer schon etwas schwerer, genügend Schüler an sich zu ziehen. Ohne städtisches Einzugsgebiet ist sie zu einem besonders hohen Prozentsatz auf Farmerkinder angewiesen. Bleiben diese aus, zum Beispiel weil sich die wirtschaftliche Situation durch die Dürre verschlechtert hat oder weil die Schule auch andersrassige Kinder aufnimmt, so trifft dies die PSK ungleich härter als die DHPS. Da heißt es, klug zu sein und richtig zu taktieren, eine „Marktlücke“ zu finden, die eine Existenz im Schatten des großen Rivalen erlaubt.
Eine bewusst oder unbewusst betriebene Methode war die Schaffung eines besonders starken Zusammengehörigkeitsgefühls zwischen Schule und Elternschaft. Das wurde begünstigt durch die Überschaubarkeit der kleinen Schulgemeinde und die Aktivitäten der Ehemaligen. Es war etwas Besonderes, in der PSK zur Schule gegangen zu sein. Wenn man seine Kinder ins Heim brachte, ergab sich ein Treffen besonderer Art: Die Eltern einer besonderen Schule pflegten eine besondere Gemeinschaft, und weil Karibib etwas abseits liegt, blieben sie auch über Nacht, was zu berühmt gewordenen Festen führte.
Etwas Besonderes war und ist auch die Nähe zur Natur. Ausflüge, Tiererlebnisse, der Heimzoo und das Herumstrolchen im Busch, der gleich neben dem Heim beginnt. Da werden Buden und Höhlen gebaut und im nahen Klippenberg verbotene Abenteuer erlebt. Kein Wunder, wenn davon die Ehemaligen bis ins hohe Alter schwärmen!
Manchmal aber halfen diese Besonderheiten nicht, die Existenz zu sichern. Und so warb man mit dem Argument, die PSK kümmere sich auf Grund der fast familiären Atmosphäre besonders um die schwachen und hilfsbedürftigen Schüler. Dies war aber ein zweischneidiges Werbeinstrument.
Читать дальше