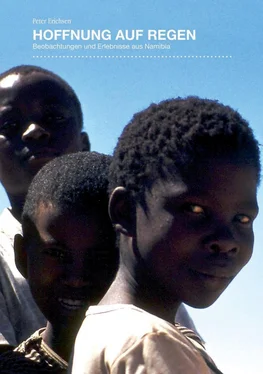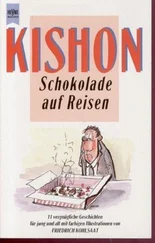1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 Da sehe ich links im Busch einen graubraunen Kopf mit schwarzen Lichtern und großen, ausgestellten Lauschern. Nur einen Augenblick, dann sind wieder Zweige davor. Ich gebe Hinrich ein Zeichen, und nun beginnt das eingespielte Team mit seiner Arbeit – wie gestern: Klopfzeichen, Abspringen, Weiterfahren, Schuss, Anhalten. Gespannt lauschen wir. Hinrich ist nicht zu sehen, aber unter seinem Schritt knackt und raschelt es. Jetzt ein Schnaufen – wie entweichende Luft aus einem Berg von Schaum.
„Lass den Hund los“, ruft der Jäger, „und bleibt, wo ihr seid!“ Er hat die Kudu-Kuh erwischt, daran besteht kein Zweifel. Aber wie? Der Hund ist ins Gebüsch gestürzt, und nach zwei Minuten gibt Hinrich Entwarnung. Wir können hinterher, aber es schnauft immer noch von vorn. Ich bin letzter und etwas ängstlich beim Zutreten. Es ist das erste Mal, dass ich zu Fuß durch den Busch gehe, und das weckt unerledigte Ängste vor Schlangen. Die Sträucher stehen weiter auseinander, als man von außen denkt, aber ich muss mir doch den Weg sorgfältig wählen und den dornigen Zweigen seitlich oder gebückt ausweichen. Etwa vierzig Meter vom Weg entfernt treffen wir auf hellrote Schweißspuren im spärlichen Gras. Aber die Fluchtreaktion war nur ein kurzes Aufbäumen. Das Schnaufen hat aufgehört. Nur noch ein paar Schritte, und wir stehen neben dem verendeten Tier.
Es muss gedreht werden, da es auf der Einschussöffnung liegt. Wir fassen alle mit an, die Antilope ist schwer, etwa vier Zentner sind zu bewegen. Der Schuss sitzt gut, fast ein Blattschuss. Immerhin war die Sicht sehr schlecht, möglicherweise hat Hinrich nicht einmal den Kopf und den ganzen Rumpf gesehen, denn er erscheint mir etwas geknickt, weil es ein weibliches Tier ist, das die beiden Schwarzen jetzt aufbrechen und aus dem sie zu allem Überfluss auch noch weißliche Fruchthüllen mit einem glasigen Kälberkörper herausholen.
Die Arbeiter geben sich Mühe, aus den Innereien alles Verwertbare herauszutrennen: Auch den mächtigen Pansen hätten sie gerne gehabt, aber der ist für die Hunde reserviert. Den langen Darm befreien sie von seinem Inhalt und stülpen ihn um. Der wird heute Abend mit Innereien gefüllt und im Feuer geröstet – ein Leckerbissen.
In der Zwischenzeit holt Hinrich den Wagen. Unglaublich, was ich da sehe: Fährt einfach drauflos! Ein Strauch nach dem andern wankt nach vorn, kippt, liegt flach und verschwindet unter der Stoßstange des Isuzus wie in dem gefräßigen Maul eines Reißwolfs – und taucht hinter dem Auspuff taumelnd und lädiert wieder auf.
So kann der ausgeweidete Tierkörper an Ort und Stelle verladen werden. Neben den Krälen wird er am „Galgen“ aufgehängt und zerlegt. Nur die zarten Lendenstücke landen in der Farmerküche. Und dann geht das Fleischessen los. Heute Nacht werden die Feuer lange brennen.
Zwei Tage später besucht uns ein Nachbar. Er trägt die Army-Uniform und gehört zum „Kommando“, einer militärisch organisierten Reservistenarmee, in der fast alle Weißen dieses Landes zusammengeschlossen sind. Sie treffen sich von Zeit zu Zeit, machen Schießübungen, Verkehrskontrollen und proben in Zusammenarbeit mit dem Militär den Ernstfall – der hier nur bedeuten kann: Die Abwehr von „Terroristen“, wie die SWAPO-Kämpfer ganz selbstverständlich genannt werden. Besonders in der Regenzeit – weil es dann leichter ist, im Busch zu überleben – dringen die „Terroristen“ von Angola her ein, versuchen die schwarze Bevölkerung (Ovambos, Kavangos, Caprivianer) zu verunsichern und betrachten es als besonderen Erfolg, ins weiße Farmgebiet eingedrungen zu sein. Es gehört zu den Schreckensvisionen der Farmer, sich vorzustellen, von SWAPOs überfallen zu werden.
Der Nachbar vom Kommando hat einen offiziellen Auftrag. Er soll den Schwarzen auf der Locasi Uniformstücke und Waffen der SWAPO-Kämpfer zeigen. Aufmerksame Schwarze haben schon oft entscheidende Beobachtungen gemacht.
Aber Hinrich muss auch selbst etwas für seine Sicherheit tun. Regelmäßig meldet er sich über Funk bei seinen Nachbarn. Die Army ist noch nicht ganz zufrieden mit dem Schussfeld. Es gibt zu viele Deckungsmöglichkeiten rund um das Haus. Feigensträucher im Garten verdecken die Sicht. Aber die Feigenblätter verdecken unserer Meinung nach noch mehr: Wenn wir uns den Ernstfall vorstellen, dann kommt uns das Farmhaus mit seinem leichten Dach wie eine Mausefalle vor: Wie leicht könnte man unbemerkt die Anhöhe mit dem Wasserreservoir besetzen! Wie leicht wäre der Diesel-Generator außerhalb der Umzäunung zu zerstören, die einzige Stromversorgung auf dieser Farm!
Es ist Abend geworden. Wir waren noch bei den Krälen am „Damm“, dort, wo das Regenwasser zusammenläuft und künstlich gestaut wird, um die Wasserversorgung abzusichern. Die Sonne war sehr schnell versunken, und über uns stand bereits dunkle Nacht. Aber hinter den schwarz liegenden Bergen glühte noch alles in leuchtendem Rot, und vor diesem Licht ragte scharfkantig schwarz das ruhende Windrad auf seinem Gerüst. Motive für ein Bilderbuch...
Irgendjemand im Haus brauchte Strom, betätigte einen Schalter, und langsam kam der Generator auf Touren, erfüllt von nun an für Stunden die Nacht mit seinem satten, dumpfen Takt.
Wir sitzen beim Abendbrot, als Frerk, der älteste Sohn, nach Hause kommt. Er spricht nicht viel, auch heute ist er sehr wortkarg. Er setzt sich, aber hat keinen Hunger. Eher beiläufig sagt er den Satz: „Ich hab ein Beest totgefahren“. Es dauert eine Weile, bis wir ihm Einzelheiten entlockt haben. Draußen, auf der Farmpad ist es passiert. Plötzlich hatte er ein „Beest“ (Rind) im Scheinwerferlicht seines VW. Er habe nicht mehr ausweichen können. Vielleicht sei er auch zu schnell gefahren, er wisse es nicht. Das Auto jedenfalls sei Schrott. Erregung ist ihm nicht anzumerken, aber am Haaransatz wächst eine Beule.
Das Abendbrot ist gelaufen. Wir brechen sofort auf, fahren im Dunkeln zur Locasi und sammeln ein paar Leute auf. Dann holpern wir über ausgespülte Querrinnen bis zur Farmpad und fahren ein ganzes Stück auf ihr entlang bis zur Unfallstelle. Sie gehört noch zu Hinrichs Farm, es ist auch Hinrichs Kuh, die da mit aufgerissenem Schädel in ihrem Blut liegt. Wir stellen unsere Wagen so, dass wir die ganze Szene mit den Scheinwerfern gut ausleuchten. An dem VW ist wirklich fast nichts mehr heil, alles eingedrückt, gesplittert. „Du hättest tot sein können“, meint Frerks Vater, der erst jetzt einen Schicksalshauch zu spüren scheint.
Währenddessen machen sich die Schwarzen an die Arbeit. Ihnen soll das ganze Tier gehören, nach dem Jagdglück von vorgestern zu viel des Guten, vor allem, wenn man keine Tiefkühltruhe hat. Aber nicht nur von den Buschmännern erzählt man sich von den ungeheuren Fähigkeiten, gewaltige Fleischmengen in kurzer Zeit zu vertilgen. Sie brechen das Rind auf, was nicht brauchbar ist, bleibt liegen. Die Schakale erledigen den Rest.
Zu Hause wird trotz der späten Stunde noch der Versicherungsagent angerufen. Und Frerk legt sich ins Bett – mit dem Ende des Schocks spürt er seine Blessuren...
Zehn inhaltsreiche Tage sind vergangen, unsere ersten Tage in Namibia. Ganz leise haben wir dieses Land betreten, keine Abordnung des Schulvereins hat uns empfangen, kein Betreuungslehrer hat uns zur Seite gestanden. Des Nachts haben wir uns hineingeschlichen und sind geradewegs auf eine Farm gefahren.
Diese Art der ersten Begegnung ist ein Glücksfall, und wir verdanken es Hinrich und Ulla, mit denen meine Frau verwandt ist. Wir sind vollgetankt mit Eindrücken und Informationen, dass uns ganz leicht ums Herz ist. Manche Beklemmung kommt gar nicht erst auf, die sonst normal wäre bei einer so einschneidenden Veränderung der Lebensumstände.
Ich denke an die vielen Farmerskinder, die ich unterrichten soll. Wie ich mich freue, dass ich jetzt schon etwas weiß über deren Alltag, über deren Probleme!
Читать дальше