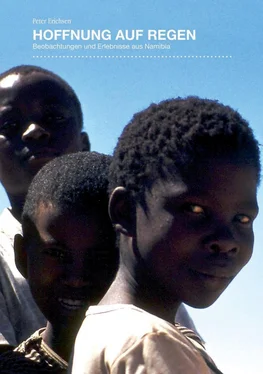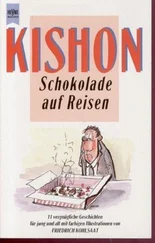In der evangelischen Kirche läuft der Gottesdienst schon. Ich fühle mich etwas beklommen, als wir den schmucklosen Kirchenraum betreten: Vor uns der lange Gang, an dessen Ende der schwarze Pastor an seinem Pult steht und uns ansieht und seine Predigt unterbricht, und links und rechts eine Masse von vielleicht 200 Köpfen, die sich uns neugierig zuwenden. Von vorne winkt uns jemand zu, es sind noch gerade zwei Stühle frei, als habe man uns erwartet.
Wir nehmen Platz, und der Pastor setzt seine Rede fort, die er auf Afrikaans und Nama hält. Abschnittsweise wird sie von einer Frau aus dem Publikum in Herero übersetzt, eine langwierige Prozedur. Der Pastor hat sein „Handwerk“ gelernt, zumindest seine Gestik und sein Tonfall bemühen sich um dramatische Höhepunkte und theatralische Wirkung – und das immer in doppelter Ausführung: in Nama und Afrikaans. Schade nur, dass er nicht so lange auf den Zehenspitzen stehen, nicht so lange den Zeigefinger am ausgestreckten Arm in die Luft stecken, nicht so lange seine kreischige Fistelstimme nachklingen lassen kann, zumindest nicht so lange, wie die langweilige Übersetzung dauert, und so sinkt er besonders an den Höhepunkten seiner Predigt immer wieder sichtbar in sich zusammen. Es fehlt der rote Faden, die Rede wirkt zerhackt.
Aber ich habe reichlich Zeit mich umzusehen, und mir wird bewusst, in welch unmöglichem Aufzug ich Rudolph an diesem Sonntagmorgen in die Kirche gefolgt bin. Die ältesten Jeans, das schlechteste Hemd waren gerade gut genug für eine Blechdachreparatur und einen Ausflug zur Spitzkoppe – und da will ich ja immer noch hin. Aber hier sitzen die Menschen im Sonntagsstaat: Mädchen in blitzsauberen weißen Kleidern, Frauen in kostbar wirkenden, spitzenbesetzten Trachten, Männer in Anzügen, mit Schlips und Kragen. Vieles von dem, was da glänzt, hält einer näheren Qualitätsprüfung nicht stand, vieles ist hundertmal gewaschen und hundertmal geflickt, aber es zeigt etwas her.
Interessant sind die Gesichter, in denen sich die rassische Vielfalt spiegelt. Einige sind ganz hell, von europäischem Zuschnitt, aber auch negroid oder mit kleinen schmalen Augen und hohen Wangenknochen wie bei den Nama-Hottentotten, dem Volk des Hendrik Witbooi12.
Und dann gibt es alle farblichen Übergänge von hell über gelblich bis tiefbraun. Es ist kein einheitlicher Typ, wie ich ihn vor einem Jahr noch erwartet hätte, jede rassische Klassifizierung nach körperlichen Merkmalen erscheint mir hier fragwürdig, ist auf jeden Fall nur eine grobe Hilfskonstruktion.
Schon immer ist es mir so gegangen: In fremden Gesichtern erkenne ich bekannte Züge, an irgendjemanden erinnert fast jedes Gesicht – wenn ich die Zeit zur Besinnung habe. Und so geht es mir auch jetzt: Was theoretisch negroid zu sein hat, sieht aus wie Uli, wie Hilke, wie Eberhard oder wie irgendjemand, dessen Name mir entfallen ist.
Vorne in der ersten Reihe sitzt die Braut, ganz in Weiß und nicht mehr ganz jung, den Blick züchtig gesenkt, und neben ihr der Bräutigam. Eine Gruppe älterer Frauen tritt vor die Gemeinde und singt mehrstimmige Lieder, wie wir sie schon vom Damara-Sender des südwestafrikanischen Rundfunks kennen, mit ihren schleifenden Harmonien, mit den starken Kontrasten zwischen tiefem Alt und kindlichen, fast schreienden Kopfstimmen. Meinem ungeübten Ohr erscheint die Komposition sehr kompliziert, für einen Moment will jede Stimme eigene Wege gehen, kräftig genug ist jede von ihnen, und doch finden sie auf wunderbare Weise in vollständiger Harmonie wieder zusammen.
Konfirmanden werden vorgestellt. Eine Taufe findet statt. Die Gemeinde singt aus voller Kraft und mehrstimmig eine Melodie, die mir bekannt vorkommt, bis ich drauf komme: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Wieder treten Gesangsgruppen auf: junge Männer, dann junge Mädchen. Der Gottesdienst dauert und dauert...
Dann endlich ist es soweit: Die Trauung findet statt. Das Paar vor dem schlichten Altar, das Ja-Wort, das Aufstecken der Ringe, der Segen des Pastors im schwarzen Talar. Eine neue Seite wird in den Gesangsbüchern aufgeschlagen, eine bekannte Melodie, und wäre nicht das Schnalzen und Klicken aus den Kehlen der Damaras und San (Buschmänner) – man könnte sich hier wie zu Hause fühlen. Überhaupt ist der ganze Gottesdienst evangelisch steril und einfallslos, wenn man einmal von den Gesängen absieht. Ich denke an die Fröhlichkeit und den Überschwang in den Gottesdiensten schwarzamerikanischer Religionsgemeinschaften – vor Jahren hab ich das einmal im Fernsehen gesehen und es hat mich tief beeindruckt.
Ein merkwürdiges Gefühl beschleicht mich, ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß: Wo ist das Ursprüngliche, das Unverwechselbare einer schwarzen Kultur, einer schwarzen Tradition? Alles scheint von anderen übernommen: Trachten der Missionarsfrauen, europäische Anzüge, deutsche Lieder, evangelische Religion...
Wie ein Bild-Reporter bewege ich mich vor dem Altar hin und her, scheinbar ohne Gefühl für die heilige Handlung. Aber ich soll das ja, obwohl auch einige Schwarze fotografieren, die wesentlich besser ausgerüstet sind als ich. Ich habe nicht einmal ein Blitzlicht...
Nach gut zwei Stunden verlässt die Gemeinde singend den Saal, draußen bleibt sie singend stehen, die bunten Farben ihrer Kleider blühen und leuchten auf in der gleißenden Sonne. Zum Schluss erscheint das Brautpaar. Es ist ein feierlicher Empfang in der winterlichen Mittagshitze, und ich mache meine letzten Bilder.
Rudolph will mich seiner Frau vorstellen. Auf der glattgetretenen Fläche neben dem Häuschen, das sie bewohnen, steht ein Dreifuß über glimmendem Holz. Einige zerlumpte Gestalten liegen und hocken herum. Ich erkenne Petrus, der bis vor kurzem im Auftrage unseres Vermieters einmal in der Woche zu uns kam, um den Garten zu pflegen. Aus irgendeinem Grunde hat er seine Arbeit verloren, von heute auf morgen, und jetzt steht er deutlich unter Alkohol.
Im Haus herrscht lebhaftes Treiben. Herero-Frauen sind damit beschäftigt, Häppchen vorzubereiten. Es ist alles sehr eng, die drei oder vier Räume sind winzig. Dann steht Emma vor mir. Sie trägt nicht die traditionelle Tracht. Über ihrem fülligen, fast weißen Gesicht wächst eine dicke schwarze Matte aus längeren Kraushaaren. Wir werden einander vorgestellt. Händeschütteln auch mit den anderen Frauen. Familienmitglieder von außerhalb sind darunter, so eine zierliche junge Frau aus Walvis Bay, modisch gekleidet, sehr attraktiv.
Ich sage Rudolph, dass ich nun gehen muss.
Gegen 13.30 Uhr bin ich am Flugplatz. Es gibt nicht mehr viel zu helfen, und zum Steinesammeln ist es zu spät.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.