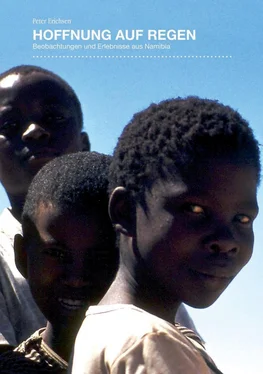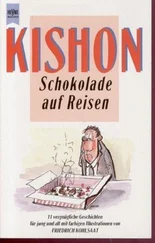Und dann leuchtet vor uns die Sonne. Keine neue Wegbiegung erwartet uns, sondern das Ende unserer Schlucht, eine Felskante, hinter der sich eine andere Landschaft dehnt, zurücktretende Berge, „Gantzoab“ eben, eine „Öffnung in die Fläche“.
Doch bevor wir die Felskante erreichen, müssen drei hintereinander liegende Wasserlöcher durchschwommen werden, die nur durch schmale Felsbrücken getrennt sind und in denen bewegungslos der blaue Himmel ruht.
Das kommt uns gerade recht, denn wir klettern schon länger als eine Stunde, und es war heiß in der Schlucht. Aber meine Erwartung, erfrischt zu werden, wird weit übertroffen: Das wonnekalte klare Wasser wirkt wie ein Rausch, bringt ein Glücksgefühl hervor, das von innen her den Hals hochsteigt und uns lachen lässt, als wären wir toll. Momente der Erregung, in denen man alles vergisst...
Als ich mich endlich aus dem Wasser löse, sattgetrunken und leicht, stehe ich am Abgrund. Zwanzig Meter unter mir ein kreisrunder See mit lehmig-braunem Inhalt, von steilen Felswänden eingeschlossen – nur uns gegenüber die Öffnung zur Fläche...
Hermann mit dem Herrenhut aus Leder verankert das mitgebrachte Seil in einer Felsenspalte und lässt uns daran hinunterklettern, und unten lassen wir uns fallen und schwimmen hinüber, erkunden das dortige Ufer, wo sich in den quer liegenden Felsrippen Teile eines alten Windmotors verkantet haben, wo wir Schlangenspuren im hellen Kies entdecken, wo in feuchten Ecken bunte Kräuter blühen.
Wo kommt nur das viele Wasser her? Das ist für mich die größte Überraschung dieses Ausflugs! Alle klagen über das nunmehr siebente Dürrejahr, und es sieht ja auch wirklich danach aus, wenn man durchs Land fährt – aber hier in dieser Schlucht herrscht Überfluss. Gut, die Verdunstung ist im Schatten nicht so groß, vielleicht wird auch der Verlust durch nachsickerndes Wasser aus unsichtbaren Zisternen ausgeglichen. Aber vielleicht hat es hier am hohen Otjipatera-Berg auch in der Dürre ab und zu geregnet, ohne dass die Menschen drumherum viel davon hatten.
Eine Überraschung ist für mich übrigens auch, mit welcher Selbstverständlichkeit – oder besser: Unbefangenheit – die Kinder einigen Risiken ausgesetzt werden. War schon das Klettern für die zum Teil erst 12-Jährigen nicht ohne Gefahr, so ist es das Abseilen erst recht – zumindest in den Augen eines bundesdeutschen Lehrers, der mit „Wandererlass“ und „Schulrecht“ zu leben gezwungen ist. Wie sind diese Kinder zu beneiden! Sie müssen nicht verstehen lernen, wa-rum ihnen die Erwachsenen dieses oder jenes vorenthalten, warum alles abgestellt ist auf das schlimme Ereignis x, das ja immerhin eintreten könnte und für das die Versicherung nur geradesteht, wenn vorher ein bestimmtes Verhalten gefordert, eingeübt und zumindest formal korrekt kontrolliert wurde...
Wie ist unser Leben in der Bundesrepublik arm geworden! Alles ist künstlich: Unsere Umwelt, das, was wir essen und was wir erleben! Wir haben keine Wildnis, wir trinken kein Wasser mehr und müssen unseren Erlebnishunger mit dem Fernsehen stillen!
Natürlich – die Begegnung mit Namibia beherrscht jetzt mein Bewusstsein, der Abstand zu Deutschland ist größer geworden. Da wird man leicht ungerecht. Ich sollte nicht die individuelle Not vergessen, in die Menschen geraten, wenn wirklich einmal etwas passiert. Aber muss deshalb bei uns drüben in Deutschland jedes normale Lebensrisiko vermieden werden, bis wir im Dschungel der Paragraphen und Versicherungen an Langeweile ersticken?
Herrliches Bild in der aufziehenden Dämmerung: Wir sind zurück im Lager, und in dem Sandbett des Riviers, an seinen buschüberwucherten Ufern haben sich auf tausend Meter Länge kleine Kindergesellschaften niedergelassen, haben ihr Nachtlager vorbereitet, Holz gesucht und Feuer gemacht. Überall, bis hin zum Eingang der Schlucht, steigen dünne Rauchsäulen auf und verraten, wo unsere 120 Schützlinge stecken.
In der Nähe der „Küche“, wo in dem Riesen-Dreifuß Rooibusch-Tee gekocht wird, türmen wir Holz für ein großes Lagerfeuer auf. Nach dem Abendbrot wird es entfacht und alles strömt hier zusammen. Zur Unterhaltung werden kleine Szenen und Sketche aufgeführt und begeistert beklatscht. Eine Vorführung ist für mich besonders beeindruckend und erinnert mich wieder an die Schattenseiten meiner neuen Heimat.
Der Farmer erteilt zwei Schwarzen den Auftrag, ein Loch zu graben. (Wofür? Das geht die Schwarzen nichts an, sie würden es ohnehin nicht begreifen.) Er macht es ihnen vor, wie man gräbt (denn Schwarze sind grundsätzlich dumm), und geht. Kaum ist er weg, stochern die Schwarzen lustlos im Sand herum, legen sich hin und teilen sich den Inhalt einer Schnapsflasche (Schwarze sind faul und versaufen bekanntlich alles.) Als der Farmer wieder erscheint und das Loch immer noch nicht gegraben ist, beginnt er zu schimpfen, nimmt sich sein Glasauge heraus, legt es neben die beiden und droht: „Ich sehe alles!“ (Schwarze sind nämlich abergläubisch und fallen auf solche Tricks herein.) Folgerichtig beginnen sie zu arbeiten. Weil sie nicht gerne beobachtet werden wollen, werfen sie das Glasauge in das entstandene Loch, das sie anschließend wieder zuwerfen. Als der Farmer wieder erscheint und die Bescherung entdeckt, jagt er die Schwarzen unter wüsten Beschimpfungen zum Teufel (sie sind eben zu nichts zu gebrauchen).
Der Sketch wird wirklich gut aufgeführt, die Zuschauer jubeln. Die fünfzehn Coloureds, unter ihnen die hübsche Adri mit ihren schwarzen Haaren und ihrer besonders dunklen Haut, sind wahrscheinlich nicht weiter irritiert. Im täglichen Heimleben gibt es schon gelegentlich rassisch gefärbte Auseinandersetzungen, und das Gefühl, anders zu sein, wird wohl durch manches böse Wort immer wieder gestärkt und durch tatsächliche Mentalitätsunterschiede auch bestätigt – aber die Weißen beschimpfen sich ja untereinander auch mit „Du Kaffer!“, und so bleibt das Zusammenleben erträglich. Kinder zanken sich nun mal und vergessen auch schnell wieder.
Aber dieser Sketch geht tiefer. Er zeigt, dass hinter der Fassade des normalen Kinderzanks tief verwurzelte Grundüberzeugungen verborgen sind. Schwarzenwitze sind keine Ostfriesenwitze.
Es ist dunkel geworden. Die Mutter eines Schülers, eine begeisterte Astronomin, richtet etwas abseits von uns ihr Teleskop auf den Saturn und öffnet einigen interessierten Kindern die Augen für das All. Aber dann werden die roten Glühpunkte unseres Lagers schwächer, und nur noch wir Erwachsenen sitzen im still gewordenen Rivier. Im Mondlicht verstecken wir die selbst gebackenen Osterhäschen. Die Ameisen finden trotz Cellophan einen Weg ins Innere, aber das schmälert am nächsten Morgen nicht die Wirkung von Ostern im afrikanischen Busch.
Es ist Sonntag. Wie immer weckt uns der Gesang der gelben Webervögel, die uns im Sommer die kleinen kunstvollen Nestampeln in die Pfefferbäume gebaut haben. Jetzt im Winter – es ist Mitte Juni – ist es nachts und morgens recht frisch, und wir haben deshalb gut und lange geschlafen.
In den letzten Tagen hat es ein sehr ungewöhnliches Wetter gegeben: Tagelang grauer Himmel, nachts stundenlang Blitz und Donner und ein dünner Regen, der sich bis gestern auf rund 30 Millimeter summiert hat – und das im Winter, in der eigentlichen Trockenzeit! Die Freude darüber ist nicht ungeteilt: Da dieser Regen ein einmaliges Ereignis bleiben dürfte, wird das keimende Gras bald wieder vertrocknen, die Saat fehlt dann in der nächsten Regenzeit. Und die Schaffarmer machen sich Sorgen um die Karakullämmer, deren Fell noch zu dünn ist, um Nässe und Kälte erträglich zu machen.
Aber heute ist der Winter wieder, wie er sein muss. Ich verlasse unser Schlafhaus und gehe über den kleinen Innenhof unter den blühenden Bougainvilleas ein paar Stufen hoch, am Goldfischbecken vorbei. Die klare Sonne steht schon hoch, aber die Welt unter ihr fröstelt noch, hier am Haus herrscht noch kalter Schatten. Wie schön, dass wir sonntags länger schlafen können! Und jetzt freuen wir uns auf ein ausgiebiges Frühstück zu fünft. Wenn die Kinder dann fertig sind, stürzen sie hinaus zum Spielen, während ich mit Imme bei einer weiteren Tasse Kaffee noch eine Weile schwatze.
Читать дальше