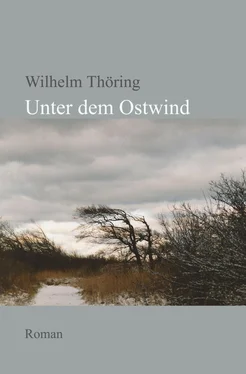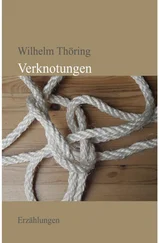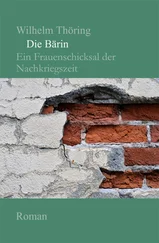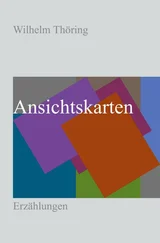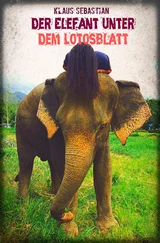Amalie betrachtet das kleine unruhige Gesichtchen, und plötzlich zieht sich etwas in ihr zusammen. In ihrem Hals wächst ein Kloß, die Tränen schießen hervor und sie reißt das Kind an sich, dass es wach wird und weint.
„Weine nicht, mein Kindchen“, schluchzt sie an seinem Gesicht. „Weine nicht, du stehst am Anfang deines Lebens, mein Herz, eines langen Lebens ... Länger, als das des alten Siegismund gewesen ist. Ja, länger, als Johann und Gotthard gelebt ...“
Ihr Weinen wird noch heftiger, sie schreit, um nicht gehört zu werden, in die Kissen.
Später hat sie das Gefühl, als habe sie den ganzen Tag nichts anderes getan, als nur geweint. Und als sie endlich zur Ruhe kommt, da fühlt sie sich leichter.
„Meinem Mann ist bei der Durchsicht der Listen aufgefallen, dass Sie vergessen haben, die Adelheit zum Konfirmandenunterricht zu schicken. Sie hätte schon konfirmiert sein müssen!“ Die Pastorin Wohlgethan sitzt sehr steif auf der Kante des Stuhls, den sie so gerückt hat, dass sie im Schatten sitzt und ihr Gesicht nur unklar zu erkennen ist.
Sie hat durch ihren Besuch Kühle in dieses Haus mitgebracht, und auch Verlegenheit und Unsicherheit bei mir und sogar bei den Kindern, findet Amalie.
Die Pastorin nippt in kleinen Schlucken von dem Tee, den Amalie für sie bereitet hat. Zuerst hat die Pastorin Tee abgelehnt: „Danke, ich möchte jetzt keinen Tee Um diese Zeit trinke ich nichts!“
Aber Amalie hat darauf bestanden. „Wie dumm, ich kann Ihnen nichts anderes als Tee anbieten. Eine Tasse werden Sie doch trinken. Nur ein Tässchen.“
Einwilligend hat die Pastorin den Kopf gesenkt: Ja, wenn es unumgänglich ist ... Widerstrebend trinkt sie den aufgenötigten Tee. Sie trinkt ihn so, dass die Hausfrau die Überwindung spüren muss.
Die Pastorin Wohlgethan ist gekommen, um Amalie Erdmann, deren Ansehen im Ort durch die zusätzlichen Webstühle und das Beschäftigen von drei neuen Webern gestiegen ist, für den neugegründeten Hülfsverein zu gewinnen.
„Was wir vorhaben, scheint vom guten Geist“, die Pastorin blickt gegen die Zimmerdecke, „begleitet zu werden, Frau Erdmann. Uns ist es gelungen, das Häuschen des Totengräbers umzubauen“, sagt sie, „bescheiden umzubauen. Unsere Mittel sind ja auch bescheiden, das können Sie sich denken“, erklärt sie mit einem dünnen Lächeln. „Aber immerhin haben dadurch sieben alte Leute für ihren Lebensabend eine Bleibe bekommen.“
Sie blickt Amalie wie aus Katzenaugen an, starr und nichts Gutes verheißend. Anscheinend überlegt sie, wie sie weiter vorgehen soll, wie sie dieser schlichten, aber doch wohl mit einem gesunden Verstand ausgestatteten Frau ihr Anliegen vorbringen soll.
Sie nippt noch einmal von dem Tee, bevor sie fortfährt: „Gutes zu tun ist unsere Christenpflicht. Ist es nicht so, Frau Erdmann?“, fragt sie listig, „dass wir, wenn wir das Leid der Leidenden und Hungernden lindern – dass wir damit die Qualen unseres Herrn zu lindern versuchen, die er für uns alle auf sich genommen hat?“
Wieder heften sich ihre Katzenaugen an Amalie, aber diesmal ist ein wenig Freundlichkeit darin oder Leutseligkeit.
Amalie nickt, sie wartet ab; sie ahnt, warum die Pastorin Wohlgethan zu ihr gekommen ist. Zuerst hat sie vermutet, es sei wegen Siegismunds Taufe, oder dass da noch etwas wegen der Beerdigung der Zwillinge zu regeln sei.
Aber schließlich hat die Pastorin ihr direkt und ohne irgendwelche Umschweife das Versäumnis vorgehalten, dass sie die Adelheid nicht zum gültigen Termin in den Konfirmandenunterricht geschickt habe.
Doch das, Amalie vermutete es, waren nur Einleitungen.
Amalie sagt: „Ja. Aber da ist noch die Sache mit dem Unterricht. Sie wissen, wie die letzten Wochen der Schwangerschaft gewesen sind ... Und dann kam der Tod der Zwillinge ...
Ja, die Adelheid muss nun in den Konfirmandenunterricht. Das Mädel ist schon über zwölf Jahre hinaus! Ich kann ja nun beide schicken, die Adelheid und die Rosa.“
„Die Rosa?“ fragt die Pastorin verwundert.
„Die ist noch elf“, sagt Amalie. „Die ist im richtigen Alter.“
„Das schon. Aber die Rosa – die ist doch recht unverständig, ist schwach im Kopf, dass sie nicht einmal in die Schule gehen kann.“ Der Kopf der Pastorin wird vor lauter Verwunderung über Amalies Vorschlag weit in den Nacken gezogen. Langsam beugt sie sich endlich vor und besieht irgendetwas in ihrer Teetasse. Sie sagt: „Wie soll dieses Kind in die Geheimnisse der christlichen Lehre eingeführt werden? Wie soll sie den Katechismus lesen und begreifen? Wie, frage ich Sie, kann bei einem solchen Menschen der Glaube an unseren Herrn Christus zu einem Baum wachsen, unter dem andere Schutz und Erquickung finden?“ Wieder streckt sich der Körper der Pastorin in die Höhe und der dicke Knoten zieht den Kopf zum Rücken hin: ’Die Rosa? Ausgeschlossen!‘ scheint sie zu denken, sie sagt es aber nicht.
„Nein“, sagt Amalie bedrückt. „Alles das kann sie nicht: sie kann nicht lesen und nicht schreiben, und sie begreift die einfachsten Dinge nur sehr, sehr schwer. Aber – ist das alles denn so wichtig? Braucht der Mensch einen klaren und gescheiten Kopf, wenn er ein gutes Herz hat?“ Sie ist mit jedem Wort leiser geworden; hilflos sitzt sie der Pastorin gegenüber und weiß jetzt nichts anderes zu tun, als die Hände im Schoß zu besehen.
Die Pastorin wartet ab. Schließlich rät sie: „Sprechen Sie mit meinem Mann darüber. Er ist der Pastor und erteilt den Unterricht und weiß, was er den Kindern zumuten kann. Aber, meine liebe Frau Erdmann, ich wollte sie dieses fragen: unser Hülfsverein braucht gute, er braucht angesehene Frauen. Bis jetzt hat mir keine Frau unserer Gemeinde, die ich in dieser Sache angesprochen habe, eine Absage erteilt. Denken Sie nur, sogar zwei Lodzer Fabrikantengattinnen, die gerne zur Mitarbeit bereit gewesen wären, haben wegen des weiten Weges absagen müssen, aber sie haben mir jede Hilfe und Unterstützung zugesagt! Wir haben Weber in unserer Stadt, die für diese Lodzer Fabriken weben, die meinen, dass in die Verantwortung der reichen Fabrikanten in Lodz auch solche Orte einbezogen werden müssen, aus denen ihre Arbeiter kommen. Zwei dieser Fabrikanten und ihre Gattinnen sind gemeinnützig und sehen das ebenso und haben zugesagt, uns nach Kräften zu unterstüten.“
Ganz offensichtlich ist die Pastorin stolz, zwei solch hochgestellte Damen vorweisen zu können. Während sie sich erhebt, leert sie die Tasse und stellt sie dann mit spitzen Fingern auf den Tisch zurück. Beim Abschied sagt sie: „Ich kann doch auch mit Ihnen rechnen, Frau Erdmann? Es ist eine ehrenvolle und christliche Aufgabe, die von diesem Verein getan wird.“
Und kerzengerade, die Welt gleichsam von oben betrachtend, weil sie durch das Gewicht ihres Haarknotens dazu gezwungen wird, schreitet die Pastorin Wohlgethan davon.
Beim Abendessen erzählt Amalie ihrem Mann von diesem Besuch. Sie erzählt, als wüsste sie nicht so recht, was von den Dingen wichtig ist und unbedingt gesagt werden muss und was sie besser für sich behält. Sie weiß auch nicht, wie er das Anliegen der Pastorin sehen und beurteilen wird. Jendrik hat diese Pfarrfrau nie gemocht. Es könnte sein, dass er unwillig wird, weil sie seiner Frau Aufgaben zumutet, die ihr selbst und der Familie lästig werden können. Hat Amalie etwa durch Äußerungen dieses Anliegen herausgefordert? Hätte sie nicht rechtzeitig das rechte und klare und entscheidende Wort sprechen müssen?
Amalie ist immer unsicher und ohne Selbstbewusstsein gewesen, doch in letzter Zeit, so kommt es Jendrik vor, hat diese Unsicherheit selbst bei den alltäglichen kleinen Aufgaben zugenommen. Dazu fühlt sie sich allzu oft müde und kraftlos. Manche Nacht liegt sie stundenlang wach neben ihrem schlafenden Mann, weil schwere und quälende Gedanken und Träume sie überfallen und ihr zusetzen. Wie kann sie sich dagegen wehren? Das Aufstehen fällt ihr schwer, sie fürchtet sich vor den Aufgaben des neuen Tags, sie fürchtet sich vor den Forderungen der Kinder, auch davor, dass mit einem fremden Menschen etwas noch Unangenehmeres und Bedrohlicheres ins Haus kommen könnte.
Читать дальше