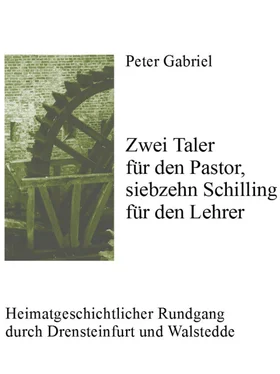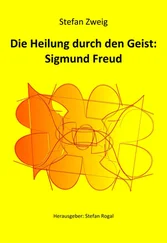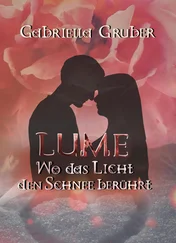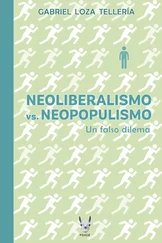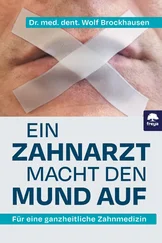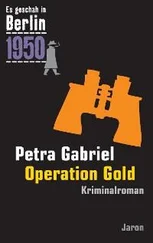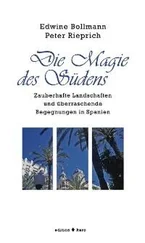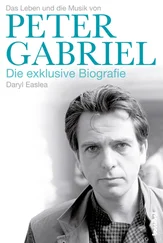Einige der Walstedder Marken hießen: Nordhölter Dreisch, alte Heide, Maykenfeld, Walstedder Feld, Hoflinde und Kurwiese. Die zuletzt genannte Mark lag beiderseits der heutigen Bundesstraße nach Drensteinfurt; Hoflinde schloss sich östlicherseits an. Das Walstedder Feld befand sich im südlichen Winkel der Straßen nach Hamm und Mersch. Um die Nutzung des Weidelandes regeln und kontrollieren zu können, hatte man Genossenschaften gegründet, denen alle Bauern angehören mussten, die ihr Vieh in eine bestimmte Mark trieben. Auch Bauern aus anderen Gemeinden konnten sich beteiligen. Ein Oberweideherr vertrat die Aufsicht, er ordnete an, wann und wo das Vieh geschüttet, d.h. zusammengetrieben und gezählt wurde.
Sorgfältig überprüfte man, wie viele Tiere der einzelne Bauer zu Beginn der Weidezeit auftrieb. Ebenso genau wurde gezählt, wenn die Weidezeit beendet war, und das Vieh in die Ställe zurückkehrte. Nur so viele Tiere durfte jeder weiden lassen, wie er den Winter über im eigenen Stall gehalten hatte. Schmuggelte jemand ein paar Rinder vom Nachbarn ein, oder vergaß er, dass Gänse nicht auf den Weiden geduldet wurden, gab es Ermahnungen und Strafen. Zumindest wurde das überzählige Vieh erst einmal festgehalten.
Zu den Weideberechtigten im Eikendorfer Feld, einer Drensteinfurter Mark, gehörten 15 Bauern, unter ihnen Pott aus Walstedde. 1705 hatte er zwei Kälber zu viel weiden lassen; von anderen Markgenossen waren verbotenerweise Ziegen oder zu viele Lämmer und Kühe aufgetrieben worden. Sogar das strenge Verbot der Gänsedrift hatte jemand nicht beachtet. Ziegen waren im Eikendorfer Feld nicht gestattet, weil sie den aufkeimenden Baumwuchs behinderten, Gänse hielt man des schädlichen Kots wegen fern. Den reuigen Sündern half die Ausrede, es habe so lange keine Viehzählung stattgefunden, Unkenntnis sei der Grund für die Missachtung der Weidegesetze gewesen. Die einbehaltenen Tiere wurden den Besitzern ohne Strafe zurückgegeben, nachdem sie Besserung gelobt hatten. Die Anzahl des Viehs, das der Bauer in die Mark schicken durfte, richtete sich nach den Steuern, die er zahlte. Pro Reichstaler durften beispielsweise im Eikendorfer Feld zwei Schafe aufgetrieben werden. Pott aus Walstedde bezahlte 1 ¼ Taler Steuern, also war er berechtigt drei Schafe weiden zu lassen.
Die Viehzählungen erfolgten unter den strengen Augen eines Notars, der darüber ein Protokoll verfasste. Als 1747 von einem Bauern viele Gänse in die Mark getrieben worden waren, musste er Schadenersatz leisten. Vier Gänse wurden ihm abgenommen, sie landeten in der Küche des Freiherrn von Bevernvörde aus Albersloh; ihm gehörte Kampmanns Hof, wo die Schüttungen stattfanden. Die Bekanntgabe der Strafen, wozu auch Geldbußen zählten, erfolgte auf den Versammlungen des Markengerichts. Alle Beteiligten hatten zu erscheinen, wenn sie ihr Weiderecht nicht verlieren wollten. Den Abschluss solcher „Gerichtsverhandlungen“ bildete meist ein feucht-fröhliches Gelage, bei dem die Strafgelder gemeinsam vertrunken wurden.
In den Jahren zwischen 1813 und 1832 wurden die Walstedder Marken aufgeteilt und an Interessenten verkauft. Eine Generalkommission stellte die Werte fest; sie richteten sich nach den jährlichen Abgaben, mit denen ein Stück Land belastet war. Zunächst galt ein 25-facher Betrag, später das 20- und 18-fache. Um die Finanzierung zu erleichtern, richtete man eine Rentenbank ein, mit ihrer Hilfe konnten die Verpflichtungen mit Laufzeiten bis zu 26 Jahren getilgt werden. Mit 23 Morgen und 30 Ruten gehörten Walstedder Mersch und Lütkengeist zu den kleineren Gemeinheiten. 8 ½ Teile davon erhielten Lückmann, 8 Teile Brünemann und Westermann, 5 Teile Heinrich Lienkamp und H. Panick, 3 Teile W. Gärtner, 2 ¾ Teile Ahlmann und 2 ½ Teile das Haus Steinfurt. Als Entschädigung für den Verlust des Markenrichteramtes mussten alle Interessenten dem Freiherrn von der Reck aus Heessen 100 Taler zahlen.
Elektrisches Licht für das Postamt Drensteinfurt
Am 19. August 1913 benachrichtigte Postassistent Helm, stellvertretender Vorsteher des Postamts Drensteinfurt, die Oberpostdirektion Münster, dass Anfang November in Drensteinfurt eine Niederspannungsanlage den Betrieb aufnehme. Öffentliche Plätze, Kirche, Krankenhaus, fast alle Geschäfte und Privathäuser sollten elektrisches Licht erhalten. Helm stellte die Frage, ob es nicht zweckmäßig sei, auch die Post an das öffentliche Netz anzuschließen. Nach Auskunft des Elektrizitätswerks Westfalen kostete die Kilowattstunde 35 Pfennig, die Zählergebühr 6 Reichsmark, Benötigt wurden zehn Lampen für Schalterhalle, Abfertigungs- und Stempelraum, Vorsteherzimmer, Packkammer, öffentliche Fernsprechstelle, Flur und Eingang. Elektrische Beleuchtung war auch vorgesehen in der Dienstwohnung des Vorstehers. Sie bestand aus fünf Wohn- und Schlafräumen, Küche und Speisekammer. Kein Licht erhielten der Unterstand für den Paketwagen und die einzige Toilette des Hauses unten im Flur.
Helm fügte seinem Schreiben einen „Beleuchtungsplan“ für das I. und II. Geschoss bei. Die Installation der Leitungen war mit 180, bzw. 108 RM veranschlagt und ging zu Lasten des Eigentümers Dr. Kimmel: Für die Lampen hatte die Post selbst zu sorgen; eine Deckenlampe kostete 1,80 RM, die Tischlampe im Vorsteherzimmer 6,15 RM. Elektrisches Licht war im Unterhalt etwas teurer als die bisher verwendete Petroleumlampe. Die Jahresmiete für das Postgebäude erhöhte sich um 19 Mark.
Die Oberpostdirektion erklärte sich grundsätzlich einverstanden. Da ihre Mittel aber „fast erschöpft“ waren, schlug sie vor, die Lampen entweder später anzuschaffen oder das Geld vom Hausbesitzer, bei 6 bis 6,5 % Verzinsung, vorstrecken zu lassen. Das letztere geschah, und so brannten zu Beginn des Jahres 1914 die ersten elektrischen Glühbirnen im Kaiserlichen Postamt Drensteinfurt.
Nach mehreren Umzügen besaß die Post seit 1895 ein festes Domizil in der Bahnhofstraße Nr. 1. Dort hatte Postverwalter Halberstadt, im spitzen Winkel zwischen Bahnhof- und Kirchhofstraße (später Rietherstraße), ein 550 m² großes Grundstück für 3500 RM erworben und mit Genehmigung des Reichspostamtes in Berlin ein zweistöckiges Haus gebaut. Fast 49 Jahre lang, vom 1. Oktober 1895 bis zum 23. März 1944, war hier die Drensteinfurter Post untergebracht. Die jährliche Miete für die Diensträume im Erdgeschoss betrug zunächst 800 RM, für die Vorsteherwohnung 300 RM.
Überall im deutschen Kaiserreich entstanden damals große, repräsentative Postgebäude, die dem Staatssekretär und früheren Generalpostmeister Heinrich von Stephan heftige Kritik wegen Verschwendungssucht einbrachten. Auch das Postamt in Drensteinfurt hatte stattliche Ausmaße, obwohl es sich nur um ein sogenanntes „Mietpostamt“ handelte. Der Unterschied zur bescheidenen Königlich-Preußischen Postexpedition war augenfällig. Halberstadts Vorgänger hatten der Post noch Einzelräume in ihren Wohnhäusern zur Verfügung gestellt. Als Bernhard Trentmann im Jahre 1885 „wegen mangelnder Amtsführung“ entlassen wurde, musste sich die Post ein neues Quartier suchen. Um in Zukunft vor solchen Überraschungen sicher zu sein, war das Haus an der Bahnhofstraße, einschließlich Dienstwohnung, für zehn Jahre angemietet worden. Übrigens wurde Trentmann 1897 wieder in Gnaden aufgenommen; so schlecht kann seine Amtsführung also nicht gewesen sein. Im selben Jahr verließ Halberstadt Drensteinfurt, nachdem er das Haus an den Bauunternehmer Mertens aus Ascheberg verkauft hatte. Von diesem erwarb es 1908 der praktische Arzt Dr. Kimmel; er baute 1910 einen Trakt mit Praxis und Wohnung an.
Das Kaiserliche Postamt III. Klasse in Drensteinfurt wurde von einem Postverwalter geleitet. Zum Personal gehörten vor der Jahrhundertwende je zwei Unterbeamte und Landbriefträger. Die einen versorgten das Stadtgebiet, die anderen Walstedde und die Bauerschaften. Unvorstellbar aus heutiger Sicht waren die Arbeitsbedingungen. Bei einer Revision im Jahre 1895 trug Halberstadt vor, dass die Unterbeamten stark überlastet seien. Er beantragte eine Erhöhung der Vergütung, aus der ihre Gehälter gezahlt wurden. Hövelmann und Kleinelanghorst hatten werktags von 6 bis 19.30 Uhr bzw. 20.15 Uhr Dienst. Ihre Mittagspause dauerte eineinhalb bis zwei Stunden. Den Sonntagsdienst versahen sie abwechselnd mit den Landbriefträgern. Viermal täglich erfolgte in Drensteinfurt die Postzustellung, hinzu kamen zehn Paketbeförderungen zwischen Postamt und Bahnhof mit dem Handwagen.
Читать дальше