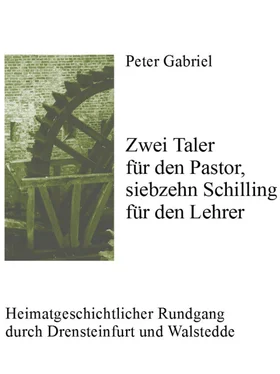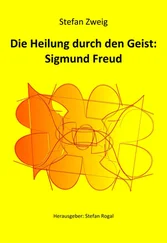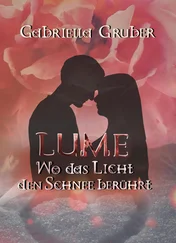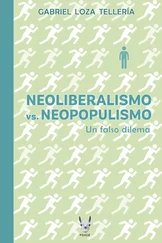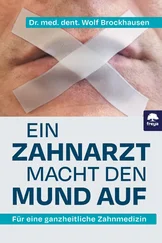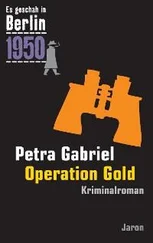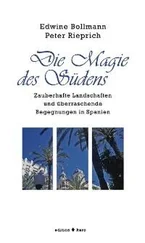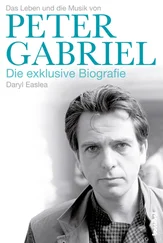Den Weg zum Heubrink war auch der Jesuitenmörder Johann Slömer, humpelnd und auf Krücken, gegangen. Ein Leineweber hatte ihm bei der Festnahme durchs Knie geschossen. Am Eingang der Lindenallee, wo heute das Kreuz steht, wurde Slömer enthauptet, sein Körper aufs Rad geflochten. Dies geschah vor 1712, als auf dem Heubrink noch eine Vorgängerin der Loreto-Kapelle stand. Auch zu ihr hatte es schon eine Wallfahrt gegeben. Mitte des 17. Jahrhunderts war sie erbaut worden; in den zeitgenössischen Quellen wird sie „sacellum prope Leprosorium“ genannt, die Kapelle beim Aussätzigenhaus. Drensteinfurt besaß auf dem Heubrink also einen Leprosenhof. Obwohl die unheilbar Kranken aus der menschlichen Gesellschaft verstoßen waren und isoliert lebten, hielt man Gottesdienst für sie in der Kapelle und reichte ihnen die Sakramente. Der Dienst an den Aussätzigen gehörte zu den Pflichten des Drensteinfurter Vikars. Als erster wird Franz Melschede genannt, die Fundation der Vikarie war bereits 1426 erfolgt.
Man betritt die Vorhalle der Loreto-Kapelle durch ein blau gestrichenes Holztor. Kräftige, hohe Bögen öffnen das Mauerwerk nach drei Seiten; eine Fensterreihe in der vierten Seite erlaubt den Blick in den Innenraum, wo ein paar Bänke und der schmucklose Altar stehen. In den Feldern der gemalten Kassettendecke leuchten goldene Sterne auf blauem Grund. Sechs Sterne sind in die Sandsteinplatten des Fußbodens eingelassen. Nach Drensteinfurter Überlieferung liegen hier sechs Mönche begraben. Rechts in der Wand ist ein imitierter Mauerriss zu sehen, den ein Blitz verursacht haben soll, als das Vorbild der Kapelle übers Meer getragen wurde. Abgeteilt durch den Altar und ein weißes Gitter liegt im hintersten Teil des Raumes die Sakristei, dort befindet sich die Küche des heiligen Hauses mit Feuerstelle und Brunnen.
Von der Kanonenkugel unter der Decke heißt es, sie habe auf wundersame Weise Papst Julius II. im Jahr 1511 bei der Belagerung einer Stadt verfehlt. Die Madonna in einer Nische hinter dem Altar und die anderen Plastiken gehören nicht zur ursprünglichen Ausstattung. Wegen Diebstahlsgefahr wird das alte Wallfahrtsbild, die Mutter Gottes von Drensteinfurt, nicht mehr in der Kapelle aufbewahrt. Das Gleiche gilt für den armen Lazarus, dem zwei Hunde die Wunden lecken. Die eindrucksvolle Holzfigur stammt noch aus der Leprosenkapelle und erinnert an die Kranken, deren Schutzpatron Lazarus war.
Vorzügliche Bildhauerarbeiten sind die Reliefs über den Türen beider Außenwände. Sie werden Johann Wilhelm Gröninger zugeschrieben. Plastisch und mit bewegten Umrissen heben sich die Figuren vom flachen Hintergrund ab. Das eine Relief stellt die Verkündigung Marias, das andere die Überführung ihres Hauses nach Loreto, translata 1291, dar. Unbefangen und realistisch hat Gröninger die Legende illustriert: Drei Engel tragen das Haus, das die Gestalt einer Kapelle hat, übers Meer. Auf dem Dach sitzt Maria mit dem Jesuskind. Unten am linken Bildrand sieht man eine von Mauern umgebene Stadt; mit geblähten Segeln fährt ein Schiff zum gegenüberliegenden Ufer, wo sich ein Baum vor dem heranschwebenden Haus verneigt. Unmittelbar an die Loreto-Kapelle ließ Engelbert von Landsberg im Jahr 1863 eine Familiengruft anbauen, die später erweitert wurde. Ihre Mauern ruhen auf einem bossierten Sockel. Wie bei der Kapelle sind die Wände durch Blendpfeiler gegliedert. Über dem Eingang hängen ein Kreuz und das Landsberger Wappen.
Am 2. November 1915 wurde hier der Reichsfreiherr Ignatz von Landsberg-Velen beigesetzt. Es war Landrat des Altkreises Lüdinghausen, Mitglied des Herrenhauses und des Reichstags in Berlin gewesen. Als er während des Kulturkampfes Stellung für seine Kirche bezog, versetzte man ihn in den einstweiligen Ruhestand. Landsbergs Beisetzung fand weit über die Grenzen des Münsterlandes hinaus Beachtung. Die Abschiedsstimmung des grauen Novembermorgens scheint das Ende des zweiten deutschen Kaiserreichs vorwegzunehmen. Drei Jahre später brach es, ebenfalls im November, nach dem verlorenen Weltkrieg zusammen.
Den heutigen Besucher der Loreto-Kapelle und der Landsberggruft bewegen Eindrücke ganz anderer Art. Im Sommer duftet es stark nach der Lindenblüte; gelegentlich rauschen Autos an den hoch gewachsenen Alleebäumen und dem Wäldchen vorbei, in dem sich Kapelle und Gruft verstecken. Besorgt schaut jemand vom renovierten Küsterhaus herüber, das wenige Schritte entfernt liegt. Fast scheint es, als seien Besucher hier nicht willkommen. Aber der Eindruck täuscht. Die Sorge gilt ungebetenen Gästen. Mehrfach drangen sie gewaltsam in die Kapelle ein. Beim letzten Mal versuchten Halbwüchsige sogar, von der Sakristei aus in die Gruft zu gelangen, scheiterten jedoch an den dicken Mauern.
Französische Emigranten in Drensteinfurt
Am 14. Juli 1789 wurde in Paris die Bastille, das berüchtigte Staatsgefängnis, von einer aufgebrachten Menschenmenge gestürmt; zwei Jahre später starb Ludwig XVI. unter dem Fallbeil, es folgte die Schreckensherrschaft Robespierres. Die französische Revolution löste eine Massenflucht in die Nachbarländer aus; der Prinz von Artois, ein Bruder des Königs fand mit seinem Gefolge Unterkunft im westfälischen Hamm; etwa 2000 Geistlichen, die sich geweigert hatten, den Eid auf die Verfassung zu schwören, gewährte das Fürstbistum Münster Unterschlupf. Unter dem Schutz des Generalvikars Franz von Fürstenberg hielten sich die Emigranten in Städten und Dörfern auf; Drensteinfurt, Walstedde und Rinkerode wurden vorübergehend Heimat für 30 Flüchtlinge.
Eine Liste gibt Aufschluss über Namen, Stand, Herkunft und Aufenthaltsort. In der Reihe Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen behandelt Peter Veddeler das Thema Französische Emigranten in Westfalen und führt ausgewählte Quellen an. In Drensteinfurt werden 30 Geistliche aufgeführt, je drei davon in Walstedde und Rinkerode. Außer Rang, Herkunftsland und Aufenthaltsort bleiben die meisten anonym, nur bei ganz wenigen erfährt man Näheres über die Art und Weise, wie sie aufgenommen und behandelt wurden. Eine Ausnahme ist der Kanoniker Denis Robelot, der im Schloss von Drensteinfurt mehrere Jahre gewohnt hat. Nachdem in Frankreich wieder geregelte Verhältnisse eingekehrt waren, kehrten die meisten Flüchtlinge in ihre Heimat zurück. Zu ihnen gehörte Robelot, seine Dankesschuld gegenüber dem Gastgeber Baron von Landsberg trägt er in zwei Zeichnungen von „Drensteinfort“ ab. Dargestellt ist der kleine Ort um das Jahr 1800, noch steht das Hammer Tor, ist die Reginakirche einschiffig, der Ort von einem Wall, mit Büschen und Sträucher bepflanzt, umgeben. Schloss und Kirche überragen die Häuser, zu den auffallendsten zählt die Alte Post.
Da es in Wiesmanns Chronik von Drensteinfurt auch einen Stadtplan gibt, der die Situation im Jahre 1800 zeigt, gehört Drensteinfurt zu den wenigen Orten des Münsterlandes, das solchermaßen in Bild und Plan der Nachwelt überliefert ist. Während die Wiesmannsche Chronik im Schloss sorgfältig aufbewahrt wird, sind die beiden Zeichnungen nur noch in Fotokopien vorhanden.
Gemächer ohne Licht und Luft
Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war Drensteinfurt Sitz eines Patrimonialgerichts, dessen Einflussbereich ursprünglich durch vier, später durch sieben Pfähle begrenzt wurde. 1808, zur Zeit des Großherzogtums Berg, wurde dieses Gericht aufgelöst, die zwei Gefängnisse im Hammer Tor und im Spritzenhaus am Kirchplatz nutzte man aber weiter. Wie Häftlinge dort untergebracht waren, geht aus der Acta betreffend die Polizeigefängnis-Anstalten im Kreis Lüdinghausen hervor.
Auf Anfrage der Königlich-Preußischen Regierung in Münster fertigte Bürgermeister Essing am 12. Januar 1834 eine recht positive Bestandsaufnahme des Drensteinfurter Gefängniswesens an. Der günstigen Verkehrsverhältnisse wegen war die Stadt Zwischenstation für Gefangenentransporte, die länger als einen Tag dauerten. Eine Zelle im Hammer Tor, das zur Stadtbefestigung gehört hatte, war für „Durchkommende und hier übernachtende männliche Gefangene aller Art“, die andere für ebensolche weibliche Gefangene bestimmt. Im Anbau des Spritzenhauses wurden Eingesessene wegen kleinerer Vergehen in „gelinden Gewahrsam“ genommen. Beide Gefängnisse befanden sich laut Essing in einem guten Zustand und „können dieselben auch von einem benachbarten Locale her geheizt werden; jenes sub C (im Spritzenhaus) ist zwar auch gut eingerichtet, kann indeß nicht geheizt werden.“
Читать дальше