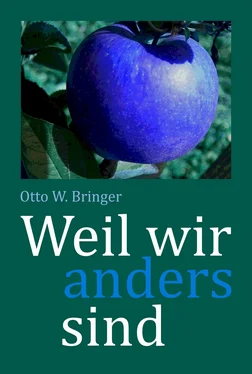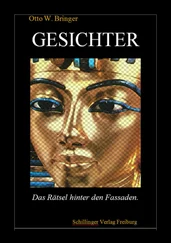Sieht mich an, als wäre sie verliebt. In mich vielleicht. In Mozart ganz gewiss. Schon redet sie weiter: „Den anderen erging es sicher ähnlich wie mir. Niemand wollte beiseite stehen, alle mitmachen. In Stimmung kommen endlich. Die Prüfungsangst vergessen. Spielten ihren Schubert, Grieg, Schumann, Brahms, Couperin und Beethoven. Wäre dieses außergewöhnliche Durcheinander sonst zustande gekommen? Ein großes Unisono glücklicher Menschen. Wie heißen Sie überhaupt?“
Schon wieder fragt mich ein Mädchen, das wie eine Frau aussieht, nach meinem Namen. Musikerin ist sie auch. Gut zusammengeklungen hat es, so chaotisch es auch war. Und alle begeistert. Für eine Sekunde sieht sie aus wie Jelena. Sie ist es nicht. Leider. Soll ich sie zu einem Kaffee einladen. Ein paar Schillinge sind noch übrig. Nein besser nicht? Ich könnte sie mögen mit ihren roten Haaren, der schlanken Figur. Sitze ich ihr gegenüber im Café. Bis in die Fingerspitzen musikalisch, wie ich bemerkte. Wir könnten zusammenspielen. Neue Stücke ausprobieren. Nein! nein! Ich mach es nicht, Jelena im Kopf:
„Man nennt mich Rôm, einfach Rôm, nichts weiter als Rôm“. Jetzt habe ich schon dreimal Rôm gesagt. Als wäre sie schwerhörig. Sieht mich an, schüttelt den Kopf und setzt sich wieder. Sehe sie kichern, die zwei Frauen auf der Bank, mir gegenüber, eng aneinander gerückt. Lachen lauthals über mich. Über wen oder was sonst? Die Prüfung haben sie noch vor sich, wie ich.
Zweifel überfällt mich. Soll ich überhaupt bleiben. Mich dem Prüfungsverfahren aussetzen? Diesem unausweichlichen Entscheid über gut oder sehr gut? Der Professor schien über unser Spiel nicht sehr erfreut gewesen. Obwohl er so tat, als dirigiere er uns. Das letzte Wort des Ordinarius entscheidet. Oder ist es ein Gremium? Mehrere Kenner, die dabei sind, wenn ich spiele? Mir zuhören, kritisch und wohlwollend, wie sie meinen. Sechs oder acht Musikprofessoren, die ihre Ohren spitzen, damit ihnen kein 32stel entgeht. Zu viel oder zu wenig ist. Zu laut oder zu leise. Zu schnell das Ganze oder zu langsam. Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Warum sollte es bei Musik-Professoren anders sein?
Bast kommt heraus, strahlt: „Zugelassen! Nächste Woche Montag meine erste Unterrichtsstunde." Alle springen auf, schütteln seine Hände, umarmen ihn. Die beiden Frauen küssen ihn auf die Wange, die rechte, die linke. Und strahlen, als wären sie selbst schon zugelassen. Es ist wie eine ansteckende Krankheit, die sich ausbreitet. Nur macht sie nicht krank, sondern optimistisch. Musik ein Medikament, das kein Arzt verschreiben muss. Das man sich selber verschreibt. Beschließe: Ich bleibe hier und stelle mich dem Professor und allen Professoren der Welt.
Sie müssen vorspielen in einem der Räume hinter der Tür Nr. 1. Höre es leise weinen, so wie nur Geigen weinen. Weinen wie ein Mensch. Ob die Prüfer sie weinen lassen bis zum Schluss? Mitten im Ton reißt es ab. Nicht lange und heraus kommt einer, die Klinke der dick gepolsterten Tür noch in der Hand. Als könnte er sie nicht loslassen nach so viel hoffen. Tränen in seinen Augen, wischt sie mit dem Rücken seiner linken Hand weg. In der rechten jetzt sein Geigenkasten. Aus Holz wie meiner. Schwarz wie meiner. Sarg, in dem die Hoffnung zu Grabe getragen wird.
„Frau Reling bitte!“ Ah, Reling heißt die mich eben noch angesprochen. Mit h oder ohne? Ausgesprochen kann man es nicht hören, steht es mitten in einem Wort. Ausnahme, sie heißt Helene. Oder einer komponiert ein Lied in der Tonart h, gesprochen wie ha. Wie Johann Sebastian Bach seine h-Moll Messe. Dieses unerhörte Meisterwerk erlebten wir im Stefans-Dom, Wien. Musik, gegen die alles andere unfertig ist, stümperhaft.
Tagelang ließ ich meine Geige im Kasten. Jeder Ton wäre mir wie eine Beleidigung vorgekommen. Selbst wenn ich Bach gespielt, hätte es wie ein misslungenes Bubenstück geklungen. Dieser größte aller Großen müsste Meer heißen, nicht Bach. Wie Beethoven einmal schrieb, der selber ein Großer war.
Mit oder ohne h kommt durch die Tür, lässt sie geöffnet hinter sich wie eine Siegerin. Lächelt vor sich hin. Schaut mich kurz an und verschwindet zum Ausgang. Die runde Uhr an der Wand dreht ihre Zeiger. Schneller als anfangs, kommt mir vor. Sitze nun schon vier Stunden hier und warte. Bis auf diesen einen haben alle bestanden. Nur noch drei auf drei Bänken von zehn. Eine Frau und zwei junge Männer. Einer von denen bin ich.
Jeder von uns allein auf seiner Bank. Sitzt wie festgenagelt und schweigt. Schweigt, denkt an Gott weiß was. Könnte sich ausbreiten, seine Taschen leeren. Sich vergewissern, ob alles noch da ist, was er eingesteckt. Mit Thermosflasche und Butterbrot frühstücken. Oder sich hinlegen und ein Stündchen schlafen. Jedes Mal auf einer anderen Bank. Warum eigentlich setzen wir uns nicht zusammen auf eine Bank? Drei zusammen sind nicht mehr allein.
Vielleicht sollten wir ein Terzett spielen von Johann Nepomuk Hummel. Damit wir in Stimmung kommen. Von Musik glücklich gestimmt, die Prüfungsangst vergessen. Ohne Absicht fällt mir Hummel ein. Johann Nepomuk, seinen Vornamen im Kopf. Nepomuk wie der Heilige an Brücken. Nicht zu fassen, was das Gehirn alles speichert. Miteinander verbindet. Ob man will oder nicht. Es ist da, ob es passt oder nicht. Jetzt passte es. „Ich hab eine Idee. Kommen ʼs mal bitte zu mir auf die Bank.“
Der Mann zögert, die Frau schon aufgestanden, eilt schnellen Schrittes mit ihrer Geige zu mir, setzt sich. Rutscht, bis ihre Hüfte meine berührt, Absicht oder? Heiser ihre Stimme: „Und nun Herr Kapellmeister?“ Sieht mich an, öffnet ihr Geigen-Etui, stimmt die Saiten. Ihr rechter Ellbogen berührt meine Schulter. Jedes Mal, wenn sie ausholt, mit dem Bogen über zwei der vier Saiten streicht. Scheint hartnäckig bestrebt, mich zu berühren. Das aber mag ich jetzt ganz und gar nicht:
„Kennt Ihr Hummels Terzett für drei Geigen? In F-Dur geschrieben, meine ich mich zu erinnern. Dann lasst es uns jetzt spielen. Damit wir in Bestform kommen.“
Jetzt steht auch der junge Mann auf, keine Geige in der Hand. Beantwortet meine Frage nicht. „Ich tät ja so gerne mit Ihnen spielen, aber ich habe kein eigenes Instrument. Muss mir immer eine Geige leihen von einem Freund, will ich üben. Der Ton einer Geige macht mich verrückt. Jauchzen möchte ich und zum Himmel fliegen. Auf Tönen, die nur die Geige von sich gibt.“
Auch so einer, der spielen muss wie ich. Aber nicht kann.
Schlimm muss sich das anfühlen. Versuche mir vorzustellen, spontan Geige spielen zu wollen und nicht können. Weil ich keine besitze, auf der ich spielen kann. Aber große Lust dazu habe. Schaffe es nicht, mir keine Geige vorzustellen. Papa schenkte mir eine, als ich sechs war. Die Geige wurde mein ein und alles. Konnte schon bald spielen was und sooft ich wollte. Frage den jungen Mann, der schüchtern vor mir steht:
„Wie wollen ʼs denn vorspielen bei der Prüfung?“ „Am Mozarteum haben sie Instrumente, die sie an Prüflinge verleihen – ohne Gebühr.“ „Kommen ʼs denn damit zurecht?
Ein Instrument muss man kennen wie einen Menschen. Bevor man sich ihm anvertraut. Und lange spielen, um ein Meister zu werden.“
Jetzt hab ich wie ein Schulmeister geredet. Aber nur wiederholt, was mir mein Geigenlehrer und mein Vater gepredigt all die Jahre. Immer wiederholt haben. Sodass es in mir ist und ohne Absicht herauskommt, wie jetzt.
Vor mir der Gemaßregelte, die Augen niedergeschlagen. Leid tut er mir plötzlich: „Hier nehmen ʼs meine Geige und spielen das Stück, das Sie bei der Prüfung spielen wollen. Um schon mal in Schwung zu kommen. Nachdem Frau …“ „Elisabeth heiße ich“ „ihres gespielt hat.“
Elisabeth hastig: „Ich spiele das Menuett in F-Dur von Josef Haydn“. „Gut und Du Kollege?“ Auf das kollegiale Du umgeschwenkt erhellt sich seine Miene: „Ich habe ein ruhigeres ausgewählt. Hoffe, es beruhigt auch mich. Bin schon ganz nervös, so kurz vor der Prüfung.“
Читать дальше