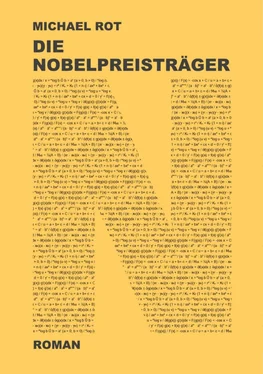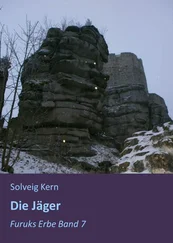Henri sehnte sich zurück in seine alte Position. Im Krankenhaus waren die Hierarchien klar geregelt, seine Kompetenz als Oberarzt war nie angezweifelt worden. Man musste auch keine Arbeit erfinden, sie war einfach da, mehr als genug. Sie war anstrengend, mühsam, allzu oft ekelerregend und abstoßend, aber der Umgang war nie respektlos. War es ein Fehler gewesen, diese Stellung aufzugeben? Hatte er es nur Louise zuliebe getan? Er wusste gar nichts mehr, alles war nur noch in einen undurchdringlichen Nebel getaucht.
Er nahm seine ganze Kraft zusammen und ging in sein Büro – als Einziger im Team hatte er ein separates Zimmer. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und sah durch das große Fenster in den Laborraum, in dem die anderen Schreibtische untergebracht waren. Emma, die junge Praktikantin aus Italien, konnte er gerade nicht sehen, sie war vermutlich bei den Technikern. Was wollte sie dort, war sie auf einen Flirt aus? Vielleicht ging es ihn ja nichts an, aber allzu private Kontakte wollte Henri in seinem Team nicht dulden. Das konnte schnell zu Konflikten führen. Théo und Lucas saßen an ihren Computern und arbeiteten, aber Raoul und Jacqueline standen jetzt an einem der Labortische und unterhielten sich. Sprachen sie über ihn? Machten sie sich gerade lustig über seine Unerfahrenheit, planten sie bereits eine Intrige? Henri wurde klar, dass er etwas unternehmen musste, um seine Position hier zu festigen und sich Respekt zu verschaffen.
Auch auf seinem Schreibtisch stand einer dieser neuen Bildschirmprojektoren, die nichts anderes waren als ein etwa siebzig Zentimeter langer und zwei Zentimeter dicker Metallstab mit zwei Gummifüßen. Henri hatte bisher nur entfernt davon gehört, aber nie einen aus der Nähe gesehen. Wie alle anderen besaß auch er ein Y-Com, hatte aber auch dessen virtuellen Bildschirm noch nie benützt. Im Krankenhaus hatte ihm ein mindestens zehn Jahre altes Gerät zur Verfügung gestanden, das er bedienen konnte, wenn es nötig war. Meist erledigten jedoch die Assistenzärzte oder Krankenschwestern die Schreibarbeiten. Bei Théo und Lucas konnte er sehen, wie ein scheinbar realer Bildschirm vor ihnen in die Luft projiziert wurde, dessen Unterkante der besagte Metallstab war. Er betrachtete das Gerät auf seinem Schreibtisch näher, konnte aber keinen Knopf oder Ähnliches finden, womit man es hätte einschalten können. Als er den Stab aufheben wollte, um an der Unterseite nachzusehen, erschien, ausgelöst durch die Berührung, der Bildschirm.
Henri erschrak so heftig, dass er den Stab von sich warf. Den lauten Aufschlag auf dem Boden hatte man offensichtlich auch im Laborraum gehört, denn alle sahen erschrocken in seine Richtung. Einen Moment lang bewegte sich niemand, aber als Henri aufstand, um den Stab zu suchen, kehrte auch im Labor wieder Leben ein. Raoul und Jacqueline beendeten ihr Gespräch und gingen an ihre Schreibtische.
Als Henri den Stab aufhob, verschwand der Bildschirm ebenso rasch, wie er erschienen war. Er stellte das Gerät auf den Tisch und berührte es erneut. Da war sie also, die neueste Computertechnologie. Die Benutzeroberfläche sah im Wesentlichen vertraut aus, und da der Metallstab auch eine virtuelle Tastatur auf den Tisch projizierte, konnte er das Gerät benützen. Diesmal nahm er sich fest vor, seine Computerkompetenz zu verbessern, in diesen Bereich musste er ganz einfach einiges an Zeit investieren.
Die Aussicht, seinen Kollegen in dieser Hinsicht bald auf Augenhöhe begegnen zu können, ließ seine Laune augenblicklich steigen. Er würde sich die Führungsrolle nicht streitig machen lassen, auch wenn ihm manche seiner Schwächen mehr denn je bewusst geworden waren. Er musste sich nur auf seine Stärken besinnen, das waren vor allem sein Organisationstalent und seine Fähigkeit, bei Konflikten zu vermitteln. Und sie sollten seine Fachkenntnisse über Bakterien nicht unterschätzen, auch wenn er noch nie etwas publiziert hatte. Auf diesem Gebiet konnte man ihm nicht leicht etwas vormachen. Sollten die anderen ruhig mit ihren Ideen kommen, er würde alles in die rechten Bahnen lenken und für eine systematische Vorgehensweise sorgen. Gestärkt durch diese Überlegungen machte er sich an seine erste Cloudnet-Recherche.
Gerade als sein Magen in ihm den Gedanken an ein Mittagessen aufkommen ließ, sah er den Rest seines Teams gemeinsam das Labor verlassen, um, wie er vermutete, Essen zu gehen – alle, außer Emma. Niemand war auf die Idee gekommen, ihn zu fragen, ob er nicht mitkommen wolle. Natürlich hätte er abgelehnt, schließlich musste er eine gewisse Distanz wahren. Der Respekt, den er sich erwartete, verlangte auch das eine oder andere Opfer. Aber sie hätten doch fragen können, aus Höflichkeit zumindest.
Er wartete etwa zehn Minuten, dann beschloss er, nach Hause zu gehen. Für heute musste es genügen. Die Basis war gelegt, sein Team installiert, im Moment waren sie nicht auf ihn angewiesen. Im Vorbeigehen sah er durch die einen spaltbreit geöffnete Tür zum hinteren Laborraum. Da war Emma! Mit dem Rücken zu ihm saß sie auf einem der Labortische, die Hände nach hinten aufgestützt, den grünen Laborkittel weit geöffnet. Mehr konnte er in dem kurzen Moment nicht erkennen, und mehr wollte er auch nicht wissen. Er verließ das Institut und machte sich auf den Heimweg, zu Fuß diesmal. Die Bewegung tat ihm gut und er stellte fest, dass seine Gedanken wieder in Gang kamen. Langsam wurde ihm klar, dass er die Sache falsch angepackt hatte. Die drei Wochen Freizeit hatte er genützt, um eine organisatorische Basis zu entwerfen, die Lebensläufe seiner Mitarbeiter zu studieren, und nicht zuletzt, um seine Begrüßungsrede vorzubereiten. Er musste sich eingestehen, dass er keinen Gedanken daran verschwendet hatte, wie die gestellte Aufgabe am besten zu lösen wäre.
Eigentlich schien es unmöglich. Wie sollten sie mit lediglich drei Fachleuten ein Medikament, eine Methode oder was auch immer entwickeln, um eines der größten medizinischen Probleme in den Griff zu bekommen, wenn nicht sogar das Problem schlechthin. Die Zahl, die er in seiner Ansprache genannt hatte, war sicher nicht übertrieben gewesen. Sechs Millionen Tote auf Grund von Antibiotikaresistenz, das hatte er der Tagespresse entnommen. In den nächsten Tagen würde er diese Zahl sicher auf Basis von seriöseren Quellen verifizieren können. Aber trotzdem, er wollte sich zwingen, über mögliche Lösungen nachzudenken. Morgen würde ihn Frau Dr. Morin mir ihren Ideen bombardieren, und so wie es aussah, stand Watanabe auf ihrer Seite.
Inzwischen hatte Henri die Boulevards des Maréchaux erreicht, die nach Überquerung der Seine direkt in den Boulevard Exelmans mündeten. Damit hatte er die Hälfte der Strecke zurückgelegt, also kein Grund, jetzt noch eine Option mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu überlegen. Solang es nicht regnete, war dieser Weg auch zu Fuß ausreichend bequem zu schaffen. Und so hatte er noch mindestens zwanzig Minuten, um weitere Überlegungen anzustellen.
Keine Frage, Antibiotikaresistenzen waren das tägliche Brot jedes Krankenhauses. Auch wenn die dermatologische Abteilung davon weniger betroffen war als etwa Geriatrie oder Intensivmedizin, so war er doch häufig damit konfrontiert gewesen. Lange Zeit hatte man in Krankenhäusern die Meinung vertreten, das Problem durch perfektionierte Hygiene unter Kontrolle bringen zu können, doch inzwischen war allen klar, dass die Lösungen vorrangig im pharmakologischen Bereich zu finden waren.
Henri war mit Bakterien quasi aufgewachsen. Als Kind hatten ihn alle möglichen Infektionen geplagt, deren Wirkungsweise er im Studium verstehen gelernt hatte. In den 1990er-Jahren wusste man noch wenig über lernfähige Bakterien, und das Vertrauen in Antibiotika war nahezu grenzenlos. Wie viele Ärzte seiner Generation gehörte auch er anfangs zu den Ungläubigen, die nicht wahrhaben wollten, wie gravierend das Problem werden konnte. Heute machte er sich keine Illusionen mehr über die Tragweite der Gefahr, weshalb ihm auch die Bedeutung seiner neuen Aufgabe bewusst war.
Читать дальше