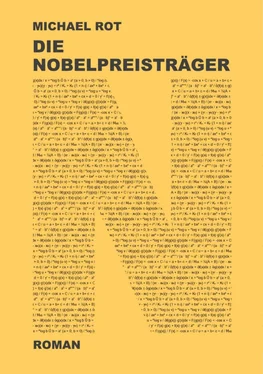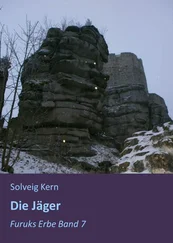»Monsieur Duritels!«
»Ja, bitte?«
Fast unhörbar für die anderen versuchte Madame Morin ihn beiseite zu holen. »Monsieur Duritels, ich sehe, Sie haben sich gut vorbereitet auf diesen Tag und Sie haben Ihre Prioritäten, aber ich möchte doch gern etwas einwenden. Ich wollte das nicht vor den anderen sagen, um nicht jetzt schon eine Diskussion loszutreten, aber ich denke, dass wir viel Zeit sparen könnten, wenn wir uns ein bisschen weniger um die Konkurrenz kümmerten.«
»Aber ...«
»Sollten wir nicht«, ließ sie ihn nicht zu Wort kommen, »sollten wir nicht vielmehr unser eigenes Wissen zusammenfassen, nicht das Wissen der anderen? Wir sind alle Fachleute, wir alle haben eine Meinung und Ideen, denke ich jedenfalls. Lassen Sie uns doch ein gemeinsames Brainstorming machen, bevor wir nach außen blicken. Wenn dabei nichts herauskommt, können wir immer noch Ihren Weg verfolgen.«
»Aber das ist genau der Zeitverlust, den ich vermeiden möchte.«
»Haben Sie meine Publikation gelesen? Ich hätte gern Ihre Meinung dazu gehört, und die von Herrn Dr. Watanabe. Auch seine Publikationen auf diesem Gebiet müssen wir durchsehen, vielleicht ist da schon ein Weg vorgezeichnet.«
»Natürlich habe ich Ihre Arbeit gelesen, und ich finde sie hochinteressant. Aber ich weiß nicht, ob das ein gangbarer Weg ist. Und was, wenn ein anderes Institut schon dieselbe Idee hatte?«
»Wir sind ja vielleicht schneller.«
»Andere haben ein ganzes Rudel von Mitarbeitern. In Indien sind sicher hunderte Wissenschaftler damit beschäftigt, und wir sind nur zu dritt.«
»Sie wissen, dass es darauf nicht ankommt. Eine einzige Idee genügt, wenn sie richtig ist. Mich würde deshalb brennend interessieren, wie Ihre eigene Meinung aussieht. Ich habe bis jetzt keine Publikation von Ihnen entdecken können.«
Plötzlich fühlte sich Henri klein und unerfahren, wie ein Studienanfänger unter lauter Fachleuten. »Meine Erfahrungen liegen im praktischen Bereich«, gab er fast kleinlaut zurück. Wieso konnte ihn schon wieder eine Frau derart einschüchtern? Gerade noch war er so stolz auf seine Rede gewesen.
»Also gut«, lenkte er ein, »ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich werde mir heute Abend Ihre Arbeit noch einmal durchsehen, und morgen setzen wir uns dann zusammen und reden darüber.«
»Danke, das gefällt mir. Ich werde Raoul auch gleich ein Exemplar geben, damit er morgen nicht unvorbereitet kommt.«
»Ich dachte eigentlich, dass nur wir beide ...«
»Nein, nein, Dr. Watanabe soll schon auch dabei sein, schließlich sind wir ein Team. Und wenn ich Sie von meiner Theorie überzeugen kann, dann wird uns seine Erfahrung von unschätzbarem Wert sein.«
Hatte sie Angst, mit ihn allein zu sein? Brauchte sie Watanabe zur Wahrung der Etikette? Wahrscheinlich war es sogar besser so, in Gegenwart eines anderen Mannes wäre sie vielleicht weniger dominant. Henri überlegte, wie er Watanabe auf seine Seite ziehen könnte. Jacquelines Arbeit brauchte er nicht nochmals zu lesen, er hatte sie noch in Erinnerung. Und er war nicht überzeugt von ihren Ideen, sie schienen ihm skurril und an den Haaren herbeigezogen.
»Dann treffen wir uns also morgen um zehn Uhr, ich informiere gleich Ihren Kollegen«, versuchte er die Diskussion zu beenden.
»Danke, dann können Sie ihm auch gleich meine Publikation mitgeben.«
Er fühlte sich zum Laufburschen degradiert, als sie ihm ein Exemplar der Londoner Monatszeitschrift Future Microbiology in die Hand drückte. »Und das ist noch extra für Sie«, ergänzte sie und überreichte ihm noch eine Ausgabe von Science. Hatte die bedeutendste aller naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften etwa auch einen Artikel von ihr publiziert? Davon träumen die meisten Wissenschaftler ein Leben lang vergeblich. Und tatsächlich verriet ihm das Inhaltsverzeichnis, dass diese Ausgabe von Science aus dem Jahr 2026 einen auszugsweisen Abdruck ihres Artikels aus Future Microbiology enthielt. Henri hatte diese Zeitschriften bisher nie gelesen, zu sehr war er im Krankenhausalltag gefangen gewesen. Er musste sich eingestehen, dass ihn Forschung bislang nicht sonderlich interessiert hatte. Erst bei der Sichtung der Bewerbungsschreiben war er auf den Artikel von Frau Dr. Morin gestoßen.
So sehr ihn auch die Sehnsucht nach einem Leben fern von kranken Menschen umgetrieben hatte, so wenig war er darauf vorbereitet. Der Wunsch, das Krankenhaus zu verlassen, war nie mit einem konkreten Ziel verbunden gewesen, so war er unversehens in einem Aufgabenbereich gelandet, von dem er wenig Ahnung hatte. Trotzdem war er enttäuscht von Jacquelines Reaktion. Er hätte sich mehr Loyalität erwartet, etwas Dankbarkeit für die neue Anstellung. Immerhin war er an der Auswahl seiner Mitarbeiter maßgeblich beteiligt gewesen, folglich schuldete sie ihm etwas.
Watanabe war gerade in einem Gespräch mit den beiden Assistenten. »In dieser Zeitschrift ist ein Artikel von Frau Dr. Morin«, nahm er ihn beiseite. »Wir wollen uns morgen um zehn Uhr treffen, um darüber zu diskutieren.«
»Ich kenne den Aufsatz«, gab Watanabe zurück, »den habe ich schon gelesen, als er erschienen ist. Eine großartige Arbeit, ich freue mich, dass Sie darauf zurückkommen.«
»Ich bin nicht davon überzeugt«, versuchte Henri einen Einwand. »Sie haben doch selbst auch einschlägige Ideen publiziert.«
»Jacquelines Ansatz ist wesentlich besser. Ich habe sogar schon ein paar Vorschläge, wie man ihre Theorie umsetzen könnte.«
»Meinen Sie wirklich?«
»Ja, natürlich. Lassen Sie uns morgen in Ruhe darüber reden. Ich wollte nur den beiden Burschen schnell noch ein paar Tipps fürs Cloudnet geben, Sie haben ihnen ja eine schwierige Aufgabe vorgesetzt.«
»Tatsächlich?«
»Datenbeschaffung von der Konkurrenz ist keine Kleinigkeit. Zum Problem der Recherche kommt ja immer noch die Frage der Legalität.«
»Ja, ja, Sie haben recht.«
»Keine Sorge, ich helfe den beiden, soweit ich kann. Ich habe da einige Erfahrung auf dem Gebiet. Während meines Studiums gab es zwar noch kein Cloudnet, aber ich habe bei einem Internetprovider gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.«
»Sie haben in Japan studiert, nicht wahr?«
»Nur zum Teil. Begonnen habe ich mein Studium an der Universität Lyon, wo auch mein Vater unterrichtete.«
»Richtig, Sie sind ja in Frankreich geboren.«
»Meine Mutter ist Französin. Aber mein Chemieprofessor war Japaner, wie mein Vater, und als er eine Berufung an die Tokyo Universität angenommen hat, bin ich mit ihm gegangen, um dort mein Studium abzuschließen. Er war es auch, der mir gleich nach dem Studium die Stellung bei dem Pharmakonzern in Lyon vermittelt hat.«
»Dort haben Sie Impfstoffe entwickelt, nicht wahr?«
»Ich war mit der Weiterentwicklung des aktuellen Typhusimpfstoffes beschäftigt. Wir konnten einige schöne Erfolge erzielen.«
»Ich beneide Sie um Ihre Fähigkeit, mehrere Sprachen zu beherrschen«, versuchte Henri ein Kompliment. Watanabes Wohlwollen konnte ihm sicher helfen. »Ich habe nur mit Mühe Englisch gelernt, und richtig anfreunden konnte ich mich nie damit.«
»Machen Sie sich nicht draus. Als Franzose verfügen Sie ohnehin über eine der bedeutendsten Sprachen, die Sprache der europäischen Kaiserhäuser.«
»Die es fast alle nicht mehr gibt«, gab Henri lachend zurück. »Also gut, dann bis morgen um zehn Uhr.«
»Ja, bis morgen.«
Henri blieb wie angewurzelt stehen. Hatte er es notwendig, sich von einem fast zwanzig Jahre jüngeren Kollegen trösten zu lassen? Er kam sich gänzlich überflüssig vor. Brauchte ihn hier eigentlich irgendjemand? Alle hatten sich an ihre Arbeitsplätze zurückgezogen, um zu erledigen, was er ihnen aufgetragen hatte. So schien es jedenfalls. In Wahrheit war ihm bereits eine Stunde nach Beginn seiner Tätigkeit die Führung aus der Hand geglitten. Er fühlte sich entmannt, betrogen um den Respekt, den man ihm hätte schulden müssen.
Читать дальше