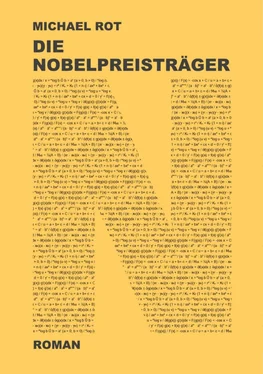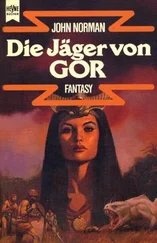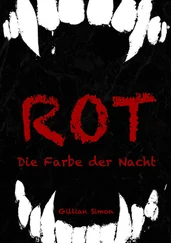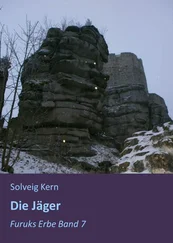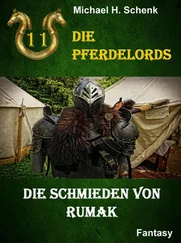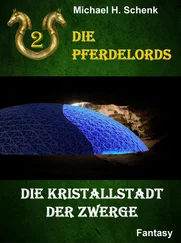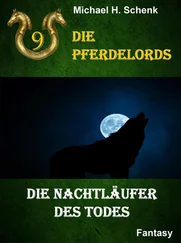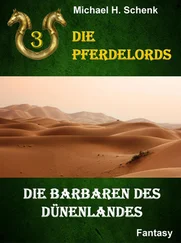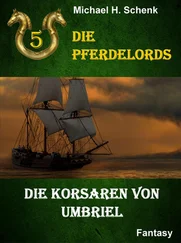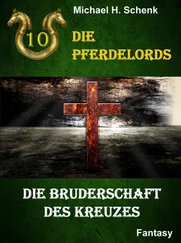Die Stelle in Tübingen war seine letzte Chance, wenn er es nicht bald schaffte, würde ihn die Kraft weiterzukämpfen verlassen. Er wusste nur noch nicht, wie er die technischen Möglichkeiten hier nützen konnte. Er müsste herausfinden, über welche Ausstattung die Labors des Physikalischen Instituts verfügten. Wenn er taktisch klug vorging, könnte er sich vielleicht Zugang verschaffen.
Sein Spiegelbild hatte sich verändert. War das noch immer das Gesicht eines attraktiven 46-jährigen? Wie lang hatte er hier gestanden? Wieso war sein Gesicht nass, auch seine Hände? Er trocknete sich ab und ging ins Schlafzimmer, ohne nochmals in der Küche vorbeizuschauen. Er schaltete den Fernsehapparat ein und suchte nach einer möglichst inhaltsleeren Comedy-Serie.
Henri Duritels stand mit nassen Händen in der geräumigen Küche und säuberte das Geschirr, bevor er es in die Spülmaschine ordnete. Seine Frau Louise war nach dem Abendbrot im Wohnzimmer der vornehmen Wohnung im 16. Stadtbezirk von Paris geblieben, um die Termine für den nächsten Tag noch einmal durchzugehen. Das kommende Wochenende würde für sie besonders arbeitsintensiv werden, weshalb er versprochen hatte, ihr diesmal noch mehr als sonst abzunehmen. Seit sie vor zwei Jahren Großeltern geworden waren, konnte sogar ein ruhiges Wochenende unvermittelt lebhaft werden. Henri liebte seine beiden Töchter, und er liebte seinen Enkelsohn über alles, aber er war immer nervös und angespannt, wenn er den Kleinen alleine betreuen musste.
Auf seine Töchter war er stolz, auf beide in gleicher Weise, obwohl sie doch so unterschiedlich waren. Die 24-jährige Lucille, Mutter des kleinen Pierre-Khaled, war ein häuslicher Typ, gleichermaßen glücklich mit ihrem Beruf als Kindergartenpädagogin wie mit ihrem vier Jahre jüngeren Ehemann Latif al-Hadad, der selbst noch Pädagogik studierte. Als einziges Kind einer Flüchtlingsfamilie aus Libyen war er in Marseille aufgewachsen und erst vor drei Jahren nach Paris gekommen. Louise und Henri hatten den strebsamen jungen Mann rasch ins Herz geschlossen und voll und ganz in die Familie integriert.
Ihre zweite Tochter, Cloë, hatte schon mit achtzehn das Elternhaus verlassen, um an der University of Birmingham Internationales Recht zu studieren. In den Ferien arbeitete sie in einer renommierten Anwaltskanzlei in Reims und war so mit ihren 22 Jahren bereits äußerst erfolgreich. Henri freute sich schon jetzt auf Weihnachten, nicht etwa, weil er besonders religiös war, sondern weil dann das einzige Mal im Jahr die ganze Familie hier zusammenfand.
Ein wenig beneidete Henri seine Mädchen um ihre innere Zufriedenheit. Seine eigene Ehe war auch harmonisch, er wollte sich gar nicht beklagen, im Grunde genommen konnte auch er zufrieden sein – zumindest waren die Umstände so, dass er es hätte sein sollen –, bislang hatte er jedoch vergeblich darauf gewartet, dass sich dieses Gefühl einstellen möge.
Die Tragik seines Lebens hatte mit der Entscheidung begonnen, Medizin zu studieren. Aber jetzt konnte alles anders werden, jetzt hatte er eine zweite Chance, und die musste er nützen – eine dritte würde ihm nicht geboten werden. Der Tag war gut verlaufen, und es war kein gewöhnlicher Tag gewesen, der letzte seines bisherigen Lebens. Es war schon ein gewisses Wagnis, mit 57 Jahren einen gut bezahlten Posten als Oberarzt an einem der besten und renommiertesten Krankenhäuser von Paris aufzugeben, um sich beruflich neu zu orientieren. Aber die Vorstellung, nicht mehr jeden Tag die Nähe kranker Menschen ertragen zu müssen, nicht mehr mit schwieligen, nässenden oder pusteligen Körpern in Berührung zu kommen, machte ihn richtig glücklich. Er hatte immer schon Probleme mit Körperkontakt gehabt; zu große Nähe anderer Menschen löste in ihm manchmal sogar körperliche Schmerzen aus. Schon oft hatte er sich gefragt, warum er eigentlich Arzt geworden war, und dann ausgerechnet Hautarzt, aber er hatte keine befriedigende Antwort auf diese Frage. Und es gab noch mehr Fragen in Henris Leben, auf die er keine Antwort hatte. Ursprünglich war das Studium nur ein Mittel zum Zweck gewesen, der ungeliebten Umgebung seiner Jugend zu entkommen; und wahrscheinlich war seine Wahl nur deshalb auf Dermatologie gefallen, um der schönen Odette nahe zu sein. Schon bei ihrem ersten Zusammentreffen hatte er sich Hals über Kopf in sie verliebt. Sie hatten dann sogar geheiratet, viel zu früh, Henri war gerade einmal zwanzig. Als sie sich drei Jahre später scheiden ließen, war er immer noch mitten im Studium. Im Gegensatz zu ihm war Odette Brian für den Beruf wie geschaffen und hatte Henri längst in den Schatten gestellt, seit Jahren schon war sie Chefin der Dermatologischen Abteilung an der Salpêtrière, dem ältesten und bedeutendsten Pariser Krankenhaus.
Arzt war auch in den 1990er-Jahren ein angesehener Beruf gewesen, und Henri hatte richtigerweise einkalkuliert, dass Nachbarn, Schulkollegen und Bekannte den Kontakt zu ihm abbrechen würden. Dass sich auch seine eigene Familie von ihm abwenden könnte, weil er ›einer von denen, ein Studierter‹ geworden war, hatte er nicht vorhergesehen. Aber der Aufstieg nach Paris, die Ehe mit einer erfolgreichen Frau, und jetzt noch die Berufung seines Lebens – all das war es wert, Jugend und Familie zu verleugnen.
Noisy-le-Sec war nicht der schlimmste aller Pariser Vororte (nicht wie etwa das südlich gelegene La Grande Borne), aber auch dort im Nordosten herrschte große Armut, immer wieder gab es Unruhen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. In dem heruntergekommenen Mietshaus direkt am Verschiebebahnhof, in dem Henri mit seiner Mutter allein aufgewachsen war, lebten auch noch eine seiner Tanten und zwei seiner Schulkollegen. So waren das Haus und seine unmittelbare Umgebung so etwas wie eine familiäre Heimat geworden; trotz des fehlenden Vaters, der schon vor Henris Geburt verschwunden war, und der kaum anwesenden Mutter, die nur mit einer Vielzahl unterbezahlter Gelegenheitsarbeiten sich und ihren Sohn über Wasser halten konnte. Henri liebte seine Mutter, und es hatte ihn tief getroffen, dass auch sie seine Berufswahl nicht akzeptieren konnte. Henris Versuche, den Kontakt in späteren Jahren wieder aufleben zu lassen, scheiterten an ihrer Überzeugung, er selbst habe sich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Es war ihr schlicht nicht möglich, in dem gelegentlich erscheinenden Besucher ihren Sohn zu erkennen. Mit einem erfolgreichen Arzt aus dem fernen Paris konnte sie kein vertrautes Gespräch führen.
Bis zu seiner Ehe mit Louise hatte Henri im 18. Stadtbezirk nahe der Metrostation Château Rouge gewohnt, damals einem der schlechtesten Pariser Viertel. Doch schon die zehn Kilometer Entfernung zu seinem Geburtshaus hatten ausgereicht, ihn seiner Mutter für immer zu entfremden. Er hatte die Besuche bald eingestellt, und so wusste sie nicht einmal von der Existenz seiner Töchter. Sie war auch nicht bereit gewesen, finanzielle oder andere Unterstützung von ihm anzunehmen, weshalb sie weit über das Pensionsalter hinaus arbeiten ging. Über die Jahre hatte Henri sich mit der Trennung abgefunden. Erst als sie vor sieben Jahren an einer ihrer Arbeitsstellen einem Herzinfarkt erlag, wurde ihm wieder bewusst, wie sehr sie ihm gefehlt hatte. Inmitten des Schmerzes war es ihm eine kleine Genugtuung, dass er wenigstens ein würdevolles Begräbnis ausrichten konnte. Auf eine Feier danach hatte er verzichten müssen, da die wenigen Bekannten seiner Mutter lieber unter sich blieben.
Henri stand da, beide Hände nass, die linke Hand voller Speisereste. Wie sollte er jetzt den Wasserhahn öffnen oder den Mülleimer, ohne alles schmutzig zu machen? Er nahm sich vor, demnächst seine Frau zu beobachten, wie sie das handhabte. Wasser war ihm zuwider, er verabscheute nasse Haut. Auch nach so vielen Berufsjahren war ihm Händewaschen immer noch eine Qual, obwohl im medizinischen Bereich kein Zweifel über die Bedeutung von Sauberkeit bestehen konnte. Schon als Kind hatte Henri das Wasser gescheut, und wenn seine Schulkameraden den ganzen Sommer über im Canal de l’Ourcq gleich hinter dem Verschiebebahnhof schwimmen gingen, war er immer allein am Ufer zurückgeblieben. Später war er ganz weggeblieben, nach und nach war er aus der Clique gedrängt und so zum Einzelgänger geworden. Ein anderer hätte sich vielleicht gegen die Ausgrenzung gewehrt, Henri jedoch war von Natur aus ein ängstlicher Mensch. Das war sicher mit ein Grund, warum er neben Medizin auch noch Mikrobiologie studiert hatte. Während seiner gesamten Laufbahn als Arzt hatte er sich immer mehr als notwendig für Bakterien interessiert, und jetzt war er zum Leiter einer Forschungsgruppe für Antibiotika am Institut Pasteur ernannt worden. Letztendlich hatte sich die Mühe also ausgezahlt.
Читать дальше