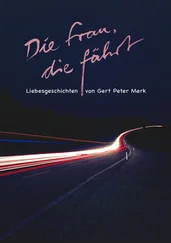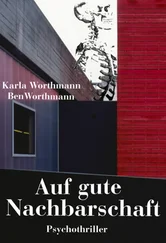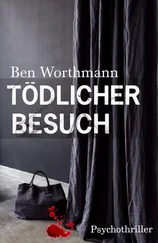Als sie wieder zur Tür hereinkam, hatte sie einen weißen Bademantel an, der kurz genug war, um viel von ihren schlanken, schönen, leicht gebräunten Beinen zu zeigen. Sie hatte ihn nur lose zugebunden. Ihr Haar war noch nass und verstrubbelt.
„So, alles erledigt. Ich muss dann mal so allmählich los”, sagte er und stand aus dem Sessel auf.
Mit ein paar schnellen Schritten war sie bei ihm.
„Muss das wirklich sein? Können Sie nicht noch etwas bleiben?”
Sie trat noch dichter an ihn heran, umklammerte seine Schultern. Der Gürtel des Bademantels löste sich und er fiel auseinander.
„Bitte bleiben Sie...bleib doch einfach hier. Wir können auch zusammen schlafen, falls du...falls Sie das wollen.”
Er wollte das nicht, obschon ihm nur zu bewusst war, dass vieles dafür sprach, dass er genau das wollte.
„Nun wollen wir doch mal vernünftig sein”, sagte er und machte sich los. Für eine Weile schwiegen sie beide. Ihre Augen suchten seinen Blick.
„Können wir denn wenigstens mal telefonieren?”, fragte sie zaghaft, als sie einsah, dass es zwecklos war. “Ich meine, falls irgendetwas ist. Ich weiß doch überhaupt nicht, was da jetzt noch alles auf mich zukommen kann, was alles noch passieren kann.”
Er gab ihr nur die Festnetznummer und sie kramte ihr Handy aus der Handtasche hervor und tippte sie ein. Dann wollte sie auch seine Adresse wissen. Er zögerte. Er hatte das dunkle Gefühl, dass es bereits falsch gewesen war, ihr seinen Namen zu nennen, aber das ließ sich ja nun nicht mehr rückgängig machen. Nichts ließ sich mehr rückgängig machen.
„Grünewaldstraße”, sagte er nur, „es ist nicht allzu weit von hier, ungefähr zwanzig Gehminuten. Steht aber auch im Telefonverzeichnis.”
Erst jetzt entdeckte sie das Geld auf dem Tisch.
„Was ist denn das dort? Was soll das?”, fragte sie.
„Das war in seiner Brieftasche.”
„Und was soll ich damit?”
„Sie können es ja spenden. Spenden Sie es für Amnesty International oder die Kindernothilfe oder von mir aus auch für Attac”, sagte er mit einem Beiklang von verhaltenem Sarkasmus. Sie quittierte es mit einem verständnislosen, wunden Blick, der an den Blick eines getroffenen Tiers erinnerte.
Es war fast Tag, als er wieder in seiner Wohnung ankam. Er duschte, während die Kaffeemaschine lief, aß zum Frühstück seine üblichen zwei Scheiben Vollkorntoast mit Magerquark und Honig und verwarf den Gedanken, sich für ein paar Stunden ins Bett zu legen. Er würde ohnehin nicht schlafen können, und außerdem war das nicht die erste Nacht, die er ohne Schlaf hinter sich gebracht hatte. Früher waren es meist Gründe gewesen, die direkt mit seinem Job zu tun gehabt hatten – Ereignisse, die sich nicht nach der Tageszeit richteten, Zeitdruck, weil ein Beitrag unbedingt fertig werden musste. Dann, vor ein paar Jahren, waren auf einmal andere Ursachen für fehlenden Nachtschlaf hinzugekommen. Sie standen zwar auch im Zusammenhang mit dem, was er tat, jedoch mehr auf eine indirekte Weise, was dann letztlich zu der für ihn selbst überraschenden Konsequenz geführt hatte, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt an nichts mehr tat, und zwar, weil er es einfach nicht mehr konnte.
Eines Morgens, nach einer Nacht, in der er sich schweißnass im Bett gewälzt hatte, ohne ein Auge zuzutun, war er in der bestürzenden Gewissheit aufgestanden, keine Zeile mehr schreiben zu können. Er saß an einem Artikel über Shanghai, die neue Boom-Town Ostasiens, und für ein paar Tage gelang es ihm, die Redaktion des Magazins zu vertrösten. Doch dann kapitulierte er. Auf Zureden eines Kollegen, mit dem er über fast alles reden konnte, wandte er sich an einen Arzt, der ihn nach kurzer Konsultation als „geradezu klassischen Burnout-Patienten” bezeichnete und ihm dringend riet, seinen Beruf nicht mehr auszuüben, zumindest nicht in dieser Form. Er erinnerte sich, dass ihm selbst regelrecht schwindelig geworden war, als er dem Arzt – und später auch einem Therapeuten, dessen Hilfe er zeitweise in Anspruch genommen hatte – davon erzählt hatte, was er gesehen und erlebt hatte, von all den endlos vielen Worte, die es gekostet und die er gebraucht hatte, diese Bilder und Eindrücke und Gedanken anderen, ihm völlig fremden Menschen zu vermitteln. Über Kriege und korrupte Politiker, Hungersnöte, Naturkatastrophen und Skandale, Sieger und Geschlagene, demente Boxer und Nobelpreisträger, über Leben und Tod.
Ihm war klar, weshalb er jetzt wieder an all das denken musste.
„Sie sind bestimmt jemand, der gar nicht weiß, was das Wort Angst überhaupt bedeutet”, hatte sie gesagt, und seine Antwort war absolut ehrlich gewesen. Ja, er wusste es, er kannte Angst, auch wenn sie sich paradoxerweise dann, wenn sie am ehesten begründet gewesen wäre, nie eingestellt hatte. In realen Gefahrensituationen – wie beispielsweise im Kosovo-Krieg oder eines Nachts in einer Straße in New York, wo ihn Jugendliche mit Messern umringt hatten – war es ihm fast immer gelungen, geradezu unnatürlich ruhig zu bleiben, sodass es ihm oft selbst nicht ganz geheuer war. Doch er hatte auch diese anderen Momente erlebt, in denen ihm der Boden unter den Füßen weggezogen zu werden schien, in denen er nicht an einer äußeren Bedrohung, sondern nur an sich selbst zu scheitern fürchtete.
Das Gefühl, das er jetzt in sich spürte angesichts dessen, was er in der zurückliegenden Nacht erlebt und getan hatte, glich allerdings weder der einen noch der anderen Angst, und er hätte nicht einmal zu sagen vermocht, ob es tatsächlich Angst war, die dabei die wesentliche Komponente bildete. Das alles passte überhaupt nicht in sein emotionales Wahrnehmungsraster – und in das rationale schon gar nicht. Dazu mutete es im Rückblick einfach zu unwirklich an.
Er hatte es immer nur mit der Realität zu tun gehabt, wobei ihn, zugegeben, das Offensichtliche nie besonders gereizt hatte. Vielmehr hatte er es immer als seine Aufgabe betrachtet, unter der Oberfläche dessen, was die anderen sahen und berichteten, zu einer noch tieferen Wirklichkeit vorzustoßen. Doch dies hier war noch wieder etwas völlig anderes.
Er räumte den Frühstückstisch ab und musste daran denken, wie er heute schon einmal aufgeräumt, wie er Gläser in jene andere Küche getragen und wie er geputzt und gewischt hatte, um etwaige Spuren zu beseitigen, die Hinweise auf den Mann hätten liefern können, dessen Körper er unter einer Laubdecke im Grunewald verscharrt hatte. Rein juristisch betrachtet galt das wohl als Strafvereitelung. Ein wenig kannte er sich in diesen Dingen aus, das hatte schon der Beruf mit sich gebracht; außerdem hatte er einige Semester Jura studiert, aber das war schon lange her. Auch die Beseitigung der Leiche fiel seines Wissens unter diese strafrechtliche Kategorie. Schließlich war er selbst ja erst ins Spiel gekommen, nachdem die Tat bereits ausgeführt war, sodass man ihm nicht Mittäterschaft oder Beihilfe anlasten konnte.
Aber dieser rechtliche Aspekt war gar nicht das Entscheidende, und eigentlich mochte er auch überhaupt nicht daran denken, in welch eine Lage er geriete, wenn es denn so weit käme, dass diese Fragen wirklich eine Rolle spielten. Denn das würde ja zugleich auch bedeuten, dass man der Frau, die diese Situation ursprünglich herbeigeführt hatte, die Tat nachgewiesen hätte. Nach allem, was sie ihm berichtet und dem Eindruck nach, den er von ihr gewonnen hatte, handelte es sich offenkundig um einen Fall von Notwehr. Wahr war aber auch, dass er nicht dabei gewesen war, dass es keinen Zeugen gab. Die entscheidende Frage lautete, ob es denn – jenseits der juristischen Betrachtung – moralisch vertretbar war, dass er ihr geholfen hatte, und er fragte sich das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Doch zu einer abschließenden Antwort gelangte er nicht. Denn sobald er sich diese Frage stellte, sah er die Frau, Julia, Julia Gerlach vor seinem inneren Auge, und dann sah er sich sofort neuen, anderen Fragen ausgesetzt, und er merkte, wie sich in seinem Gehirn die Gedanken aufhäuften, kippten und zu einem Gebilde von wirrer Struktur ineinander schoben.
Читать дальше